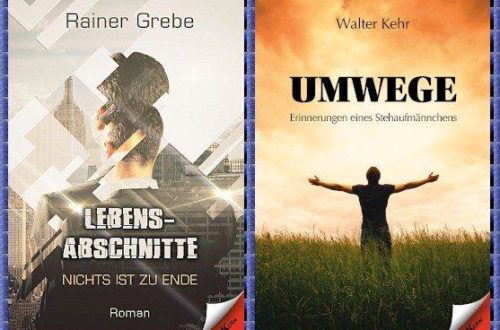Eine Ehe-Überprüfung, eine Bibel an der Parteischule, ein Mord im Film und Georgs Geschichte – Fünf E-Books von Freitag bis Freitag zum Sonderpreis
Einem ebenso ungewöhnlichen wie großen Kriminalfall widmet sich Heiner Rank in seinem Kriminalroman „Meineid auf Ehrenwort“ aus dem Jahre 1959.
Und in seinem Buch „Georg“ erzählt Jürgen Leskien die abenteuerliche Geschichte von – von Georg natürlich …
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Und da hat die Literatur schon immer ein gewichtiges Wort mitzureden und heute erst recht. Auch in dieser Woche geht es um den Schutz von Tieren, sogar um den Schutz besonders schöner und besonders gefährdeter, weil sehr seltener Tiere. Und diesmal wendet sich der Autor, der wie immer bei seinen Büchern nicht nur den Text, sondern auch die hervorragenden Fotos dazu geliefert hat, an ganz junge Menschen. Schließlich kann man nicht früh genug damit beginnen, die Schönheit und Schutzbedürftigkeit von Natur und Umwelt zu erkennen und zu erleben. Und da muss man manchmal auch ein großes Geheimnis für sich behalten können …
Erstmals 1988 veröffentlichte Wolf Spillner im Kinderbuchverlag Berlin „Im Walde wohnt der schwarze Storch“: Anna kennt sich im Wald aus, denn ihr Vater ist Förster. Ihr Vater hat sie oft auf seine Jagdkanzel in der Nähe des Weihers mitgenommen. Dorthin kommen die Wildschweine. Als sie ihrem Vater die vergessenen Kiefernpflanzen nachbringen will, steigt sie noch schnell neugierig auf die Kanzel hinauf. Plötzlich entdeckt sie ein großes Nest auf einem Baum. Da ist ja auch ein großer Vogel, der rasch davonfliegt. Es ist ein Märchenvogel. Gibt es Störche, die schwarz sind, oder bunt und mit roter Brille um die Augen?, fragt sie aufgeregt ihren Vater? Niemand außer den Eltern darf von ihrem großen Geheimnis wissen. Noch nie haben die seltenen Schwarzstörche in ihrem Wald gebrütet und sie sollen doch im nächsten Jahr wiederkommen. Wunderbare Fotos von Wolf Spillner ergänzen die schöne Geschichte für Kinder ab 4 Jahre. Und so erfährt das kleine Mädchen von dem Großen Geheimnis:
„Im Walde wohnt der schwarze Storch
Anna bringt dem Vater fünfhundert kleine Kiefern in den Wald. Das ist ein Klacks für sie, denn die Bäumchen sind noch nicht viel länger als Bleistifte. Eng aneinander stecken sie in einer flachen Kiste. Anna hat sie auf den Gepäckträger ihres Fahrrads gebunden. Sie fährt die schmalen Wege entlang, auf denen kein Pferdewagen mehr durchkommt und auch nicht das Geländeauto vom Oberförster. Die Stare flöten, und über ihr rufen die wilden Tauben aus den Baumkronen. Vor dem Weiher am Eichenkamp haben Windröschen und Lerchensporn einen Blütenteppich um die alten Eichen gestickt. Er ist so schön, dass Anna ihn von oben sehen möchte.
Sie lehnt ihr Rad an eine der hohen Eichen. Ihr Vater Lothar hat vor Jahren eine Jagdkanzel in den Baum gebaut. An den Weiher kommen oftmals die Wildschweine. Sie suhlen sich in seinem Schlamm.
Anna ist gerade erst acht Sprossen die Leiter hinaufgeklettert, da hört sie ein mächtiges Rauschen über sich. Aus der anderen Eiche fliegt ein Vogel fort. Er ist groß und dunkel, hat lange Beine, einen langen Schnabel und mächtige Flügel. Ehe sich Anna ihn richtig anschauen kann, ist er verschwunden. Wie ein Geist! Erst jetzt entdeckt sie ein Reisigbündel in der Eiche, und sie klettert rasch zur Kanzel hinauf. Auf einem dicken Ast der Nachbareiche liegt breit und schwer ein Vogelnest aus Knüppeln und Zweigen. Darüber wundert sich Anna sehr. Sie weiß genau, es lag im Vorjahr noch nicht dort.
Vorsichtig späht Anna aus den Schlitzen der Jagdkanzel nach draußen. Vielleicht kommt der große Vogel zurück? Warten hat sie vom Vater gelernt, wenn sie mit ihm das Wild beobachten durfte. Unter ihr blühen die bunten Blumen, neben ihr singen die Amseln, und sie hört die Spechte im Wald trommeln. Niemand kann sie sehen. Es gefällt ihr, so im Baum zu sitzen.
Auf einmal klingt ein seltsamer Ton durch den Wald: „Hiii – hiüüüüü!“ Dann rauschen große Flügel, und auf dem Nest vor Anna landet ein mächtiger Vogel. Er faltet seine Schwingen zusammen.
Anna kann es gar nicht glauben: Da steht ein Märchenvogel! Er funkelt und schillert. Sein Schnabel und seine Beine scheinen zu brennen, so flammend ist ihr Rot! Ebenso rot sind seine Augen gerandet, als trüge er eine leuchtende Brille. Wie ein Storch sieht der Vogel aus und doch auch ganz anders!
Störche kennt Anna gut. Sie haben ihr Nest auf der Scheune hinter der Schule. Sie sind weiß und schwarz, und sie können laut klappern. Vielleicht ist dieser Vogel ein ganz besonderer Storch, überlegt Anna. Der Vater wird es wohl wissen. Als Förster muss er die Vögel in seinem Wald kennen. Aber zunächst will Anna diesen Vogel genau beobachten! Der Vogel putzt sich. Dann gähnt er, und Anna muss auch gähnen, so weit reißt er den Schnabel auf. Danach schließt er die dunklen Augen. Als er endlich wieder aufwacht, stochert er mit dem Schnabel im Nest zu seinen Füßen. Es ist sorgsam mit trockenem Gras ausgelegt. Schließlich hebt er die großen Schwingen und fliegt davon.
Anna schaut auf ihre Uhr. Mehr als eine Stunde ist vergangen! Sie muss sich sputen, um rechtzeitig noch am Kahlschlag zu sein, wo der Vater mit seiner Brigade die jungen Bäumchen pflanzt.
„He, Papa“, schreit Anna, „ich bringe euch noch Kiefern!“
Vater Lothar kommt ihr entgegen, nimmt die grüne Mütze ab und wischt sich den Schweiß vom kahlen Kopf. Er bindet die Kiste vom Fahrrad los. „Die habe ich heute Morgen glatt vergessen, Anna! Danke dir!“
„Du, Papa“, sagt Anna, „gibt es Störche, die schwarz sind, oder bunt und mit roter Brille um die Augen?“
„So ein Quatsch aber auch.“ Die dicke Frau Findeisen, die neben ihnen Kiefern pflanzt, lacht. „Störche mit roter Brille, haha!“
Förster Lothar schüttelt den Kopf. „Wie kommst du denn darauf?“, fragt er.
„Ich hab ihn gesehen“, sagt Anna laut. Das soll Frau Findeisen ruhig hören!
„Nicht schwindeln, Anna“, sagt der Vater. Er legt ihr den Arm um die Schulter und geht ein Stück mit ihr zur Seite.
Was soll das, denkt Anna. „Musst ja nicht glauben“, sagt sie, „aber steig mal auf deine Kanzel. Am Schweinetümpel. Da ist nämlich ein Nest, und da steht einer drauf, so ein bunter. Hat rote Beine und einen Schnabel wie Feuer!“
„Nicht so laut“, sagt der Vater. Sein Gesicht ist ganz ernst. „Wenn das stimmt, muss es nicht jeder hören!“
Anna ärgert sich. „Du meinst wohl, ich spinne?“
„Nein“, sagt der Vater, und Anna begreift gar nichts mehr.
„Sag doch, was das für ein Vogel ist“, bohrt sie. „Tust ja mächtig geheimnisvoll! Oder weißt du’s nicht?“
Da lächelt der Vater, und ganz leise sagt er: „Aber ja doch! Das kann nur ein Schwarzstorch sein! Noch nie waren Schwarzstörche in unserem Wald. Sie sind sehr, sehr selten. Noch seltener als Adler. Und du hast sogar ein Nest gefunden!“ Er schüttelt wieder den Kopf. „Kaum zu glauben!“
„Ist doch prima«, sagt Anna. »Wenn sie brüten und Junge haben, dann werden es mehr!“
„Genau! Und deshalb darf niemand davon wissen, Anna! Das Nest muss ein Geheimnis bleiben, verstehst du?“
„Nein“, sagt Anna, „verstehe ich nicht.“
„Sie sollen nicht gestört werden“, flüstert der Vater. „Mal gut, dass sie sich den allerstillsten Winkel im Revier ausgesucht haben. Sie können in Ruhe brüten, niemand kommt dorthin!“
„Ist aber nur einer“, gibt Anna zu bedenken.
„Ich möchte wetten, da ist noch ein zweiter“, meint ihr Vater, „und das werden wir bald erfahren!“
Anna nickt. Sie möchte mehr von dem bunten Märchenstorch wissen.
Ein Geheimnis zu tragen, ist schwer. Sie darf den Freundinnen nichts erzählen und auch nicht den Jungen in ihrer Klasse. Das muss sie dem Vater versprechen.
Nicht so schwer ist es, mehr vom Schwarzstorch zu erfahren. Schon am nächsten Sonntag schleichen Tochter und Vater zum Eichenkamp. Aus der Ferne können sie mit dem Fernglas das große Nest erkennen. Aber kein bunter schwarzer Storch steht oben in der Eiche.
„Nun glaubst du mir wohl nicht?“, fragt sie.
„Aber ja“, sagt der Vater, „ich seh doch ein Nest!“
Als sie kurz darauf versteckt in der Kanzel sitzen, sieht Anna, dass der Storchenhorst frisch mit Moosstücken belegt ist. Sie will es dem Vater sagen, da klingt der pfeifende Ton durch die Baumgipfel.
„Gleich kommt er“, flüstert Anna, und wirklich, schon rauschen die Flügel, und auf dem Nest landet der schwarze Storch.
„Oi, ist der schön“, brummt der Vater.
Der Vogel hebt und senkt den Kopf. Er spreizt die weißen Federn unter dem Schwanz wie einen Fächer, und er pfeift immer weiter sein klingendes „Hiiii – hiiiüüüüü!“
„Warum macht er das“, flüstert Anna.
Der Vater zuckt die Schultern. Er hat noch nie einen Schwarzstorch gesehen. Kurz darauf landet ein zweiter Storch auf dem Nest. Er ist genauso schön und farbig. Die Vögel werfen ihre Köpfe auf und nieder, und ihre roten Schnäbel leuchten. Dann schreiten die Schwarzstörche umeinander. Sie kraulen sich gegenseitig die schimmernden Halsfedern. Der eine ist etwas größer. Er streckt ein Bein vor, legt es dem anderen auf den Rücken, öffnet die Schwingen und springt hinauf. Die Vögel sehen einer Riesenblume ähnlich.
„Wie unser Hahn“, flüstert Anna. „Nun können sie Eier legen und Kinder haben.“
„Pst“, macht der Vater, aber die Störche merken nichts. Sie putzen ihre Federn wieder glatt, treten auf dem Nest hin und her, und nach einer Weile fliegen beide davon. Und damit zu den anderen vier Sonderangeboten dieses Newsletters:
Erstmals 1974 veröffentlichte Elisabeth Schulz-Semrau im Mitteldeutschen Verlag Halle-Leipzig ihre Erzählung „Jedes Leben hat auch seine Zeit“: Eine Ehekrise nach zehn gemeinsam verlebten Jahren veranlasst eine Journalistin, ihre Ehe auf ungewöhnliche Weise zu überprüfen. Sie verlässt ihren Mann, um mit ethisch-moralischen, beruflichen und intimen Fragestellungen zu wechselseitig tieferem Verstehen zu finden: „Ich bin nicht weggelaufen, um die Ehe zu beenden, sondern damit sie dauern kann.“ Elisabeth Schulz-Semrau lässt in dieser Erzählung durch psychologisches Ausloten – selbst des individuell Unterbewussten, das in der Lebenspraxis eine nicht unwichtige Rolle spielt – die Möglichkeiten eines neuen Zusammenlebens auf einer neuen Stufe intimer Gemeinsamkeit und gesellschaftlicher Verantwortlichkeit deutlich werden. Die Autorin fordert den Leser ständig zum Mitdenken und Mitentscheiden bei dieser Überprüfung auf, und gerade das macht die Lektüre des Buches zu einem besonderen Gewinn. Hier der Beginn des 2. Kapitels, in dem sich die Frau mit journalistischen Mittel ihren Mann und sich selbst zu erklären versucht:
„Grundkonzeption: Sehr weich, sehr empfindsam. Das würde ihn, ergriffe er keine Gegenmaßnahmen, wehrlos, wenn nicht gar den Dingen ausgeliefert sein lassen. Also Fell darüber, manchmal glatte Haut – das ist die, wo Leute ihm Unempfindlichkeit vorwerfen – und Dinge gemeistert! Diese Felltarnkappe beziehungsweise Haut macht sein Verstand. Dieser variabel, erfinderisch, witzig, fantasievoll, verrückt bis zum Makabren (auf ungeheuer solide Leute so wirkend).
Euphorische Stimmungen, wenn diese Empfindsamkeit das Verstandsfell durchstößt, dann zu wahrhaft genialischen Handlungen fähig (dafür Beweise!). Dabei manchmal von einer erstaunlichen Fähigkeit, Dinge zu durchschauen, zu erahnen, zu prognostizieren (Tante Olga: „Steffans siebter Sinn“).
Dann aber aus wolkenlosem Himmel (muss so eine Art gesunder Ausgleich sein, der aber immer als dicke Ungesundheit in andre Augen geht) erschütternd dumm, und das meist begleitet von raubritterlichem Barbarismus!
Danach: Entsetzte Augen, hilflos, wie’n Bengel und „siehste, so bin ich eben, ich kann viele Stunden ganz was Gutes machen und dann in einer halben so’n Mist, dass alles kaputt ist.“
Weiser Narr oder närrischer Weiser?
Nach zehn Jahren einen noch so mögen? So? Nein anders, sehr anders. Mehr? Unreal?
Es sind gestern Abend nicht mehr als zwei gewesen. Zwei Doppelte. Der erste ziemlich kurzschluckig hinuntergegossen, musste dazu dienen, an diesen hiergebliebenen einst gekannten Gesichtern vorbeizukommen, hinter dem kleinen Mauervorsprung auf dem alten Freund aus grünem Plüsch bei sich selbst anzukommen.
Bei mir selbst sein konnte ich im Gegensatz zu Steffan immer am ehesten zwischen vielen fremden Gesichtern. Oft hatte ich mich während des Studiums, wenn irgend so ein journalistisches Beweisstück zu liefern war, mitten in das Auf und Ab eines Kaffees oder einer Kneipe gesetzt. Vielleicht war es so: Alles, was ich aus der Bekanntheit meiner vier Wände nicht mehr heraussehen konnte, gaben mir fremde Gesichter her. Diese hier schienen mich mit ihren eigenen Geschichten zu überfallen. Geschichten, bei denen ich das Gefühl hatte, ich hätte es irgendwann schon einmal gelesen, in einem Heimatkalender vielleicht oder in der beschaulichen Wochenzeitschrift „Daheim“, die Tante Olga von unserm lang verstorbenen Onkel Anton wie eine Art Reliquie aufbewahrte. Dabei, ich geb’s zu, würde eine neue moderne Fassung der Geschichten oder eine andere Sicht sie womöglich literaturfähig für unsere Tage machen.
Zum Beispiel der alte Doktor Hecht, unser ehemaliger Lateinlehrer. Ein frauenscheuer Mensch, dem wir die große, unglückliche Liebe zugedichtet, den wir jede Stunde mit neu konstruierten Frisuren herausgefordert hatten, immer völlig vergeblich. Hinter ihm steckt, nun erst recht nach dem Tod seines winzigen Mütterchens, von uns die Zwetschgenmuttel geheißen, eine traurige apathische Einsamkeit. Er nennt’s wahrscheinlich Haltung. Und wahrscheinlich lässt er dieses Gefühl, das er sich hält, als einzige Gärung seines Lebens allabendlich aus dem Bierglas hochsteigen. Ein Mensch an einem separaten Tisch.
Dem Druckereibesitzer Backhaus und Söhne, jetzt sicher staatlich, dem sich seinerzeit die Frau erhängt, weil … lieber Gott, welch spießiges, bösartiges Gewäsch mochte hinter all dem stecken.
Ich aber musste endlich an meine eigene Geschichte denken. Also: zweiter Schnaps.
Außerdem hießen die Blicke dieser Patriarchaten mehr denn in unserer großen Stadt: Was denn, eine Frau allein und –? So antwortete mein zweites Glas, mit langsamer Genüsslichkeit geleert: Allerdings, ihr Blaubärte im Likörgläschen! Ganz allein und durchaus zufrieden damit, wenn sie euch betrachtet!
So also ist das – ist man mit seinem Mann uneins, gleich wird daraus eine ganze zu bekämpfende Männerwelt …
Und da ist dieses vielleicht fragwürdige Charakteristikum meines lieben Mannes geworden, das überprüft – aber auch heute noch standhält.
Wie denn an jemanden herankommen, der einem so vertraut ist, dass darüber sprechen schon wieder völlig unvertraut macht? Wenn ich bisher an ein Porträt heranging, konnte ich immer nur äußere, einzelne Dinge anpeilen. Als erstes jedenfalls. Ich befragte die Arbeitskollegen, den Partner, beobachtete im Tätigkeitsbereich, registrierte Aussagen, Entscheidungen, Erreichtes, Unerreichtes – Mosaiksteine, die schließlich ein Bild ergaben. Eines allerdings, das nach meinem Wollen geordnet war.
Stimmt nicht ganz. Der gesellschaftliche Auftraggeber hat schon die Finger darauf, dass es nicht womöglich ein Bild von mir wird.
Auch Steffan muss – soll eine Er-Schöpfung sein!
Aber ich könnte hundert Details erzählen, wie ein Puzzlespiel zusammensetzen – es wird einfach kein Steffan!
Irgendetwas fehlt immer oder ist zu viel. Hier ein Stück Nase, da ein Stück Charakter. Muss ich also eine Art Charakterfabel als Kernstück des Mannes Steffan finden!
Ich habe übrigens einmal erlebt, wie ein Freund von uns, Maler und bekannter Porträtist, das Porträt einer Frau begann, eine Auftragsarbeit, die er anfangs in flüchtigem Kennen ähnlich und in der Gesamtheit richtig erfasste. Als er jene Frau jedoch näher kennenlernte, ziemlich nah, wurde das Porträt immer unähnlicher. Er brauchte ganze drei Jahre dazu, um es dann wiederum – allerdings jetzt wirklicher – aus dem Pinsel zu bekommen.
Ich aber habe keine drei Jahre zur Verfügung, nicht einmal drei Monate. Weder für meinen Auftrag noch – was wichtiger ist – für unsere Standortbestimmung.
Dabei muss ich zugeben, dass bei meinem Charaktergerippe die Relationen auch noch schief sind.
Seine Schwächen haben wohl etwas Übergewicht bekommen, weil es mich eben als Letzterlebtes besonders empört hat. Den letzten Satz, der jetzt gestrichen wird, habe ich übrigens erst zu Hause dazugekritzelt. Vielleicht kam er von der Empörung, mit der ich mich durch die Mannglotzerei aus der Kneipe arbeiten musste oder – ach, was weiß ich …“
Erstmals 1981 veröffentlichte Elisabeth Schulz-Semrau ebenfalls im Mitteldeutschen Verlag Halle-Leipzig ihren Roman „Die Beurteilung“: „Wo sind die Blitze, Kolja?“, fragt Gisela Hildebrand ihren erwachsenen Sohn. Kolja, Jahrgang 1951, stellt Ideale in Frage, die vor allem von seiner Mutter auf ihn übergegangen sind. Trotz Scheidung seiner Eltern verliefen seine Kindheit und Jugend ohne tiefgreifenden Widerspruch, haben Schule und Universität ihn in dem bestärkt, was ihn mit seiner Mutter verbindet. Doch da siedelt das Mädchen, das er liebt, nach Westberlin. Da stößt der junge, unbequeme Kunstwissenschaftler in seiner Arbeitsstätte, einem Museum, zunehmend auf Unverständnis und Widerstand. Eine negative Beurteilung verhindert, dass er an die Universität in die Forschung zurückkehren kann. Ist er selbstgerecht, wenn er mit seinen aufbrechenden Zweifeln seine Mutter attackiert? Sie wehrt sich, gerät aber zugleich in Widerstreit mit sich selbst und mit jenen, denen gegenüber sie ihren Sohn verteidigen will. Aus der Sicht beider Hauptfiguren werden Lebenserfahrungen und -ansprüche zweier Generationen konfrontiert und auf ihr produktives Miteinander hin untersucht. Und auch hier präsentieren wir den Anfang des 2. Kapitels, in dem wir Bemerkenswertes aus dem Leben von Koljas Mutter und über die damaligen Zeitumstände erfahren:
„Kolja, bitte tu nichts Unüberlegtes, schrie sie in die Sprechmuschel. Hörst du? So sag doch was! Sie hielt den Hörer noch eine Weile am Ohr, ehe sie begriff, es kam nichts mehr.
Verdammter Bengel! Sie kaute es förmlich im Munde herum, dachte gleichzeitig – eine Wiederholung früherer Situationen – wann kann ich endlich anfangen zu leben? Verflucht noch mal, das muss doch mal drin sein, muss doch mal anfangen.
Sie saß eine ziemliche Zeit reglos am Schreibtisch und sehr müde, ihren Kopf in beiden Händen, dazwischen das Manuskript, an dem sie gerade gearbeitet hatte, mit einem Zettel voll winzig geschriebenen Notizen. Sie hatte für die nächste Lektoratssitzung ein Gutachten vorzulegen.
Sie fühlte Angst.
Gisela Hildebrand hatte in ihrem Leben verschiedene Ängste kennengelernt. Diese, die Angst um den Sohn, wäre vielleicht als natürlichste zu bezeichnen gewesen, wenn sie sich nicht mit etwas koppelte, was sie in den letzten Jahren kaum mehr gefühlt, aber, wie sich jetzt erwies, nicht vergessen hatte.
Ich war einfach zu jung damals, als ich reinging, grübelte sie.
Was hatte ich denn schon der Partei zu bieten?
Sicher wie die meisten von uns: Idealismus. Aber ohne Wissen und Persönlichkeit, das ist ja wie Wasser in hohler Hand aufbewahren wollen.
Und wie damit solche sogenannten Fälle verkraften, ohne dass Narben verblieben wären?
Gerade achtzehn war sie, als man ihr den Stempel „versöhnlerisch“ aufdrückte.
Sie arbeitete seit einigen Monaten an der Schule, in der sie zuvor, wegen der Umsiedlung überaltert, die zehnte Klasse verlassen hatte.
Ein ehemaliger Mitschüler, nun elfte Klasse, hatte sich zu verantworten, warum er amerikanische Unkultur verbreite. Er trug wohl so die ersten Kreppsohlenschuhe, die oben an der Küste auftauchten nach der Teilung, nun auch deutschen Geldes. Sein Klassenlehrer hatte in der entscheidenden Konferenz seine eigenen Füße in Tischhöhe gehoben, auf die durchgelaufencn Sohlen gewiesen und gesagt: Aber mit solchen Tretern werde ich wohl auch nicht den Sozialismus erreichen …
Parteiversammlung, Parteiverfahren. Gisela wagte es, das Argument ihres ehemaligen Lehrers und jetzigen Kollegen richtig zu finden, wahrscheinlich, weil sie ihn als überlegten, klugen Pädagogen kennengelernt hatte.
Schlimmer aber traf, was eigentlich Egbert, Koljas Vater, hätte treffen müssen. Sechs, sieben Jahre waren sie verheiratet, da wurde er zum Studium an eine Parteischule delegiert. Für drei Jahre hieß es.
Einesteils war sie froh darüber gewesen, in ihrer Ehe muckerte es ziemlich, und sie hoffte auf Gesundung durch Abstand. Zum anderen aber lud ihr sein Studium eine kaum zu bewältigende Schwierigkeit auf. Sie kam frühestens um achtzehn Uhr aus Berlin von der Arbeit, wohin mit Kolja?
Eines Abends nach ungefähr einem halben Jahr stand Egbert mit Gepäck und Bücherstapel vor dem Gartentor. Sie hatte sich, seit sie mit dem Kind allein war, daran gewöhnt, abzuschließen.
Rausgeflogen wegen ideologischer Koexistenz, sagte er, sah aber nicht sonderlich unglücklich aus.
Passiert war nicht, wie sie vermutete, dass ihr lieber Mann wieder einmal einen kleinen Fremdgehversuch unternommen hatte, passiert war: Er hatte sich beim letzten Wochenendurlaub irgendwo eine Bibel geborgt, er las Feuchtwangers „Josephustrilogie“, und da ihn seine Eltern mehr in der germanischen als in der christlichen Religion erzogen hatten, wollte er über die Geschichte der Makkabäer nachlesen. Er las und stellte die Bibel in seinem Zimmer, das er mit zwei anderen Genossen teilte, ins Regal neben die Klassiker. Es wurde ruchbar: Egbert Hildebrand besitzt eine Bibel, liest darin, glaubt also daran.
Aussprachen, Versammlungen, Diskussionen.
Genossen, die Bibel ist ein kulturhistorisches Werk, ein Stück Literatur. Ihr könnt sogar ökonomische Strukturen der Sklavenhaltergesellschaft daran ablesen, Anfänge des Frühkapitalismus …
Ja, mir gefallen die Geschichten darin, wie mir Homers Geschichten gefallen. Es käme doch niemand auf die Idee, mir Glauben an Homers viele Götter vorzuwerfen …
Ein Genosse, der die Bibel liest, ist fromm, muss gläubig sein, also abergläubisch!
In einer Parteischule ist sein Platz jedenfalls nicht.
Gisela war fassungslos. Aber verdammt noch mal, warum hast du dich nicht wenigstens dahinter verschanzt, dass du schließlich auch dort bist, das Gegenteil gelehrt zu bekommen. Nein, Egbert, das darfst du nicht auf sich beruhen lassen, es geht doch auch um die Partei …
Egbert hatte sie mit der überheblichen Nachsicht betrachtet, die sie früher für jungenhaften Übermut hielt, jetzt aber an ihm hasste. Bist du wirklich so naiv, Kindchen, dass du von diesen Neandertalern Gerechtigkeit erwartest?
Neandertaler – sie hatte vor allem an ihren kleinen einbeinigen Vater gedacht, dem diese Neandertaler seine menschlichste Möglichkeit boten, ihn herausholten aus dem Lakaienkorsett eines Hausmeisters für Herrschaften eines großen Vorderhauses, selbst für die Leute des Hinterhauses in einer Kudamm-Nebenstraße, und der darum selber solch ein Neandertaler wurde …
Es hatte einen ziemlich ekelhaften Streit gegeben, und sie hatte schließlich geschrien: Wenn sie für dich schon Neandertaler geworden sind, dann hab wenigstens den traurigen Mut, dich von ihnen zu lösen!
Für wie blöde hältst du mich eigentlich? hatte er geantwortet, und für sie war nun auch diese Seite der Gemeinsamkeit fragwürdig geworden. War das noch der, in dessen Gesicht sie im flüchtigen Schein einer Fackel an jenem siebten Oktober, dem Geburtstag ihres Vaters übrigens auch, ihr Einssein mit diesem Ereignis zu sehen geglaubt hatte? Damals war sie diesem schönen blonden Kerl begegnet.
War es der, der zu seinem Forstmeister-Elternhaus anfangs konsequent alle Brücken zerstörte, als der Vater so etwas von sich ließ wie: Mein Gott, Kinder, musstet ihr denn nun wirklich den Namen eures Kindes von diesen Asiaten ausleihen …?
Deutschlandtreffen, Weltfestspiele, und, und, und – neben wem war sie da marschiert? Mit wem gegangen? Wer war jederzeit der Erste, das war Egbert, der Kommunist. Mochte sein, sie war damals ungerecht. Hatte nicht sein Wesen aufschließen können. Was sollte es. Er war heute ein bekannter ADN-Korrespondent in einem kapitalistischen Land, nachdem er sich viele Jahre in verschiedenen sozialistischen Ländern – na sicher – bewährt hatte. Wer er heute war, wusste sie kaum, interessierte sie auch nicht. Allerdings – im Zusammenhang mit dem Sohn …
Nein, dachte sie, sagte es womöglich laut: Und auch darum! So etwas konnte man doch nicht machen, durfte man nicht. Heute nicht mehr! Es waren ja seit jenem Vorkommnis mit seinem Vater fast zwanzig Jahre vergangen. Wie sollte ein junger Mensch sie sehen?
Gerade Kolja!
Gisela Hildebrand stand vom Schreibtisch auf, löste den Haken der Balkontür und trat ins Freie.
Sie bewohnte eine Zweiraumwohnung im fünfundzwanzigsten Stock eines achteckigen Hochhauses und empfand als größte Annehmlichkeit die Höhe über der Stadt und die Weite des Ausblicks, obwohl sie das nicht ganz entschädigte für die Anonymität, die Fremdheit und den Massenbetrieb, der hier herrschte. Es war ein Haus mit einer Einwohnerzahl von über tausend.“
Erstmals 1959 druckte der damalige Verlag Kultur und Fortschritt Berlin den Kriminalroman „Meineid auf Ehrenwort“ von einem gewissen A.G. Petermann – das war das Pseudonym von Heiner Rank: Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wird in dem Potsdamer Filmstudio ein Film über ein Verbrechen, das die deutschen Besatzer in der Sowjetunion verübt haben, gedreht. Die Dreharbeiten ziehen sich aufgrund immer neuer Pannen hin. Schließlich prüfen deutsche und sowjetische Kriminalisten, ob Sabotage im Spiel ist. Sie tappen im Dunkeln, bis ein Mord geschieht. Zunächst aber hören wir, wie der Autor überhaupt Kenntnis von seinem Stoff bekommen haben soll, wobei er hinzufügt, Figuren und Fabel des Romans seien erfunden. Aber ob das so stimmt?
„Ein nächtlicher Bericht
Bei mir um die Ecke wohnt ein alter Mann, ein Rentner. Er wohnt dort seit vielen Jahren. Bis vor gar nicht langer Zeit kannte ich ihn nicht, nicht einmal von Ansehen. Solch ein Nebeneinanderhinleben ist in Berlin, an dessen Peripherie ich wohne, nichts Verwunderliches; desto verwunderlicher aber ist der Kriminalfall, der zum Erlebnisbesitz dieses alten Mannes gehört. Es ist ein großer Fall, außerordentlich verwickelt, scheinbar rätselhaft und zugleich charakteristisch für die Zeit, in der er sich ereignete. Wie ich mich überzeugte, waren sich, als man ihn löste, die meisten Zeitungen darüber einig, dass er „in die Geschichte der Kriminalistik eingehen“ werde. Er ist nicht in sie eingegangen. Er ist vergessen worden. Die Menschen haben ihn aus ihrem Gedächtnis ausgebucht, ihn abgeschrieben wie die Zeit, deren Umstände ihn hervorbrachten, wie die Brotmarken, den Rucksack, die Hefeflocken und das Alcolat, jenes merkwürdige Schnapssurrogat. Zu Unrecht?
Zu Unrecht!
Freilich: ihn hat man nicht vergessen, den alten Mann, der in meiner Nachbarschaft wohnt und dem dieser Fall Gelegenheit gegeben hat, die Klugheit, den Scharfsinn und die Energie seiner Klasse so erfolgreich mit der raffinierten Verschlagenheit ihrer Feinde zu messen.
Wilhelm Derdey ist heute neunundsechzig Jahre alt.
Sein linkes Bein, auf dem er schon lahmte, als ich ihn vor Jahren zum ersten Mal sah, ist inzwischen ganz steif geworden. Der Fußtritt eines Wachmannes hatte ihm in Buchenwald die Kniescheibe zertrümmert. Jetzt, da ich Derdey etwas näher kenne, übersehe ich auch nicht mehr, dass der Wagen des Arztes oft vor seiner Haustür hält. Abends brennt bei ihm lange Licht. Derdey liest. Oder er hat Besuch: Genossen, Freunde.
Er ist alt geworden, ein Invalide, ein Veteran, zu hinfällig, um im täglichen Dienst seinen Mann zu stehen; aber deshalb ist er nicht einsam. Man denkt an ihn, und er weiß das; und wo es ihm möglich ist, setzt er die ihm verbliebene Kraft noch opferfreudig ein für die Sache, der sein schweres Leben gewidmet war.
Bei solch einem Einsatz habe ich Derdey kennengelernt. Es war am Tage nach einer der letzten Volkswahlen. Der Zufall hatte es so ergeben, dass ich gemeinsam mit ihm im Wahllokal Dienst tat. Wir hatten Nachtwache, von null bis vier Uhr, um die Einrichtung und die Wählerlisten vor eventuellen Anschlägen zu schützen. Bis nach Westberlin ist es von uns aus nämlich nur ein paar Steinwürfe weit.
Wir hatten uns am Fenster des dunklen Wahlzimmers niedergelassen. Von dort aus konnte man den Hauseingang gut überblicken. Es war eine warme Juninacht voller Duft und Gesumme, sternklar und mondhell, eine Nacht, die jung macht und träumerisch. Obwohl wir uns beide vor romantischen Empfindungen hüteten, weil unsere heutige Aufgabe sich ganz und gar nicht mit ihnen vertrug, merkte ich doch, wie das eindrucksvolle Bild, das die glitzernden Gärten vor unserem Fenster boten, den alten Derdey in seinen Bann zog. Desto verblüffter vernahm ich seine plötzliche Frage.
„Du bist doch beim Film, nicht?“
Ich bejahte wahrheitsgemäß, und zwar mit einem leichten Seufzer, denn dergleichen bekomme ich oft zu hören. Meist folgt dann die Aufforderung, etwas von der in den Augen vieler Menschen anscheinend recht abenteuerlichen Filmarbeit zu erzählen. Aber das geschah diesmal nicht. Vielmehr begann Derdey nach Personen zu fragen, von denen ich einige aus meiner beruflichen Tätigkeit kannte. Von anderen aber – und das waren weit mehr – wusste ich nur vom Hörensagen, dass sie einmal in der Filmindustrie wichtige Posten innegehabt hatten. Direktor Peukert – Dr. Huppert – der Produktionsdirektor Düsterhöfft … Die Namen hatte ich wohl gelegentlich aufgeschnappt, und irgendwoher war mir auch bekannt, dass der eine oder der andere noch heute in wichtigen Funktionen tätig war. Aber mit unserem Filmstudio hatten sie längst nichts mehr zu tun. Issajew, der sowjetische Hauptdirektor? Aber wir waren doch schon seit Jahren kein SAG-Betrieb mehr, hatten also weder einen sowjetischen Hauptdirektor noch irgend sonst sowjetische Berater.
Ich sah zur Seite. Derdey hatte sich aus dem Fenster gelehnt. Seine buschigen grauen Haare bewegten sich im warmen Nachtwind.
„Ich habe sie alle genau gekannt“, sagte er leise, und mir schien es seltsam vieldeutig zu klingen. Ich beugte mich vor.
„Du warst auch im Studio beschäftigt?“, fragte ich verhalten. Ich glaube, es gelang mir, meine Verwunderung einigermaßen zu verbergen.
Er lächelte. Langsam schüttelte er den Kopf, ohne mich anzusehen.
„Ich war Kriminalkommissar.“
Kommissar? Plötzliche Neugier mischte sich in mein Erstaunen. Unter den jetzigen Diensträngen in der Volkspolizei gab es keinen Kommissar mehr, das wusste ich.
Ich fragte zurück, und er antwortete. Ich fragte eindringlicher, und er gab genauere Auskunft. Unversehens glitt er ins Erzählen hinüber, berichtete, redete sich warm.
In dieser Nacht bekam ich Kenntnis von dem absonderlichsten Kriminalfall, der mir seit langem zu Ohren gelangte und der es nach meiner Ansicht verdient, der Vergessenheit entrissen zu werden.
Wenn ich offen sein will, muss ich allerdings sagen, dass ich zunächst recht ungeduldig Derdeys Erzählung folgte. Einesteils deswegen, weil die uns umgebende silbergesättigte Juninacht meine Gedanken nicht gerade in die Bahnen eines Kriminalfalles lenken wollte, vor allem aber deshalb, weil der Alte so lange Zeit brauchte, bis er auf den eigentlichen Kern seiner Geschichte zu sprechen kam. So glaubte ich wenigstens.
Derdey fragte mich aus, ob ich mich noch genau an die Handlung des Films „Meineid auf Ehrenwort“ erinnere, der Ende 1950 seine Premiere erlebt und dabei einen großen Erfolg errungen hatte. Als ich bejahte, genügte ihm das aber keineswegs, sondern er rekapitulierte mit mir die Vorgänge, die in jenem Film eine Rolle spielten, bis in jede Einzelheit. Nur widerwillig ging ich darauf ein. Er ließ sich aber durch nichts von seiner auffälligen Umständlichkeit abbringen, bis ich langsam begriff, wie wesentlich und wichtig die Vorgänge innerhalb des genannten Films für den sich anbahnenden Kriminalfall waren, ja, dass dessen Lösung im Grunde von ihnen abhing. Eine Tatsache, die um so verblüffender war, als sich die Verbrechen, von denen Derdey mir in jener Nacht erzählte, auch noch bei den Dreharbeiten zum „Meineid auf Ehrenwort“ ereignet hatten.“
Erstmals 1984 erschien im Kinderbuchverlag Berlin „Georg“ von Jürgen Leskien: Georg stellte das Rad hart auf das Pflaster zurück, das Vorderrad hüpfte. Und du?, fragte er und warf den Kopf ein wenig zurück. Wie geht es dir, hast du eine neue Geschichte geschrieben? Er wusste, dass ich diese fordernde, vorlaute Art nicht mochte. Ich sah ihn an. Georg wurde unsicher … Es ist die Geschichte eines Jungen. Eines Jungen unserer Stadt. Ich glaube, sie ist ziemlich aufregend. Also eine Abenteuergeschichte! Es ist deine Geschichte, Georg! Georg wurde rot über beide Ohren. Na, hör mal! Geht denn das? Er fuhr sich aufgeregt mit der Hand übers Gesicht. Mit allem Drum und Dran? So gut ich es konnte, in allem. Und was werden die Leute von uns denken, von dir und von mir, wenn sie es lesen?… Also, wollen wir mal reinschauen in Georgs Geschichte, zunächst zumindest ein bisschen …
„Kapitel 1
1
Wiesenstein war tatsächlich nicht groß. Aber für Georg war es ein wichtiges Dorf. Zu Wiesenstein gehöre ihr Kinderheim, und hier war er zu Hause.
Lange hatte Georg gesucht, aber er fand nur eine einzige Karte, auf der Wiesenstein eingetragen war. Und das auch noch falsch, denn der Bach floss östlich am Dorf vorbei, aber die Kartenzeichner hatten ihn mitten durch das Dorf gelegt. Das wünschten sich die Dorfbewohner schon immer, besonders in den heißen Sommermonaten. Nur vom Wünschen allein kommt der Bach nicht ins Dorf, und die Karte ist verkleinerte Natur, die lässt sich nicht betrügen, da muss man genau sein. Ein falscher Strich, und schon versinkt ein Streifen Ackerland, in dem Maulwürfe leben und der mit seinen Rüben eine ganze Kuhherde ernährt.
Georg kann sich keine genauere Arbeit vorstellen als die des Kartenzeichners. Karten können viel erzählen, mit Karten kann man sich Erdteile ins Zimmer holen und sie in Ruhe betrachten. Das können sonst nur Kosmonauten. Sie wischen mit dem Ärmel die runde Sichtscheibe ihres Raumschiffes blank und sehen mit dem einen Blick die Küsten Afrikas und mit dem anderen schon Australien.
Es gab Tage, da holte sich Georg den Globus aus dem Regal und suchte darauf den Punkt, der Wiesenstein heißen könnte. Mit Mühe fand er das Land, in dem er lebte. Es war klein und vorwiegend grün und ihrem Wiesenstein sehr ähnlich. Klein und grün und im Sommer warm und selten mit traurigem Regen.
Er wurde auf die Kartenzeichner traurig, wenn einer seiner Freunde keinen Besuch bekam. Es gab viele Karten, die über interessante Burgruinen und über Autoraststätten Auskunft gaben, nur Wiesenstein suchte man vergebens. Das fand Georg sehr ungerecht, denn in einer Burgruine können Kinder nicht wohnen, und dort ist auch niemand ,der Besuch erwartet. Um aber jemand besuchen zu können, muss man wissen, welche Straße zu ihm führt. Deshalb war Georg dafür, dass Wiesenstein in alle wichtigen Karten eingetragen wird. Niemand der Erwachsenen soll sich herausreden können, er habe Wiesenstein nicht gefunden oder er wisse nicht, dass es das Kinderheim Wiesenstein gäbe!
Doch jetzt beschäftigte Georg etwas anderes. Lange schon lag er im Gras unter den hohen Kiefern, starrte durch die Äste der Bäume in den Himmel, bis ihn eine Erschütterung, die aus der Erde kam, aufscheuchte. Die Erde bebte in Wiesenstein! Georg lag ganz still und lauschte. Er erinnerte sich genau, nur einmal schon hatte er das Beben der Erde so deutlich gespürt wie eben. Das war nicht allzu lange her, ein halbes Jahr vielleicht. Zum dritten Mal war er bei Eisenhuts gewesen. Mit Mareks Freunden spielte er auf dem Hof. Alle hatten sich versteckt, Marek wollte sie suchen. Kaule aus dem Nebenhaus war sogar in den leeren Müllcontainer geklettert. Georg lag im Hinterhof auf dem Bauch, ganz dicht neben dem alten Motorrad, hielt den Atem an und wartete auf Marek Eisenhut. Er wünschte, in eine Fliege oder in einen Motorradreifen verwandelt zu werden, für zehn Minuten nur, denn Kaule hatte bestimmt: Wer zuerst entdeckt wird, muss aus dem Selbstbedienungsladen ein Päckchen Kaugummi besorgen. Besorgen hieß bei Kaule: Eine Runde mit dem Korb durch den Laden, ein Griff zum Kaugummi und mit harmlosem Gesicht an der Kasse vorbei. Die anderen sehen durch die Schaufensterscheiben zu. Davor hatte Georg Angst gehabt, denn er glaubte, dass Marek zuerst nach ihm suchen würde. Und mitten in diese Angst hinein spürte er plötzlich das Beben. Er spürte es ganz deutlich, vor allem an den Fingerspitzen. Die Erde zitterte, ganz kurz nur, es war wie ein Frösteln im eisigen Wind.
Natürlich entdeckte Marek ihn zuerst, aber er sagte auch gleich, dass diese Kaugummiaktion großer Quatsch sei und dass Kaule sich etwas Besseres ausdenken sollte!
Als es dunkel wurde, klemmte Kaule Marek am Müllcontainer die Hand. Vielleicht wegen des Kaugummis. Marek konnte die Hand trotzdem noch bewegen, und sie spielten weiter – und keiner der Jungen schien das Beben bemerkt zu haben.
Später dann, im Halbdunkel des Treppenhauses, als Georg mit Marek allein war, fragte er ihn. Nun ja, begann Marek seine Erklärung und streckte sich. Georg kannte das an ihm. Immer wenn Marek sich streckte, sagte er etwas Wichtiges. Aus dem dreizehnjährigen Marek wurde ein fast erwachsener Mensch, wenn auch nur für Minuten. Marek wusste viel.
Nun ja, fuhr Marek nach dem Recken und Strecken fort, das sei normal hier in Berlin. Die Stadt schwimme als riesige Erdscholle auf einem Sumpf. Marek war sehr verwundert, dass Georg während der Besuche die langen Betonstifte nicht gesehen hatte, die für die Fundamente der hohen Häuser in Richtung des Erdmittelpunktes getrieben wurden. Er fragte Georg, wartete aber die Antwort nicht erst ab. Es gehe ganz einfach darum, erläuterte er weiter, die Stadt festzunageln, sie zu verankern. Ja, sie solle nicht in Richtung Ostsee abtreiben oder zur Elbe oder zur Oder, was ja noch näher wäre. Die Stadt sei was Besonderes. Die Häuser stünden auf tausend Füßen, die hohen jedenfalls. Und sie stünden im Sumpf, bis zu den Knien gewissermaßen. Und es käme vor, dass diese Erdscholle manchmal ein wenig zittere – ein gewöhnliches Schollenbeben, ja, ein Schollenbeben.
Das alles gehöre in den Bereich der Physik. Physik der Erde, so schloss Marek und streckte sich wieder.
Georg hatte aufmerksam zugehört und, obwohl er das mit dem Sumpf und der Scholle nicht ganz verstand, Marek nicht durch Fragen unterbrochen. Er hatte versucht, sich den riesigen Hammer für die Betonstifte vorzustellen. In Richtung des Erdmittelpunktes … Die Bemerkung zur Physik fuhr Georg in die Glieder. Das war sein schwacher Punkt: Physik. Und das wusste Marek.“
So fängt sie also an – Georgs Geschichte. Und sie bleibt abenteuerlich und spannend und liefert damit einen weiteren Beweis, wie ein oben beschriebenes Experimentierfeld für menschliches Leben aussehen kann. Und am Ende kommt es einem doch fast so vor, als würde man Georg tatsächlich kennengelernt haben. Und dafür hat Jürgen Leskien gesorgt.
Und dieser Kennenlern-Effekt, als hätte man sie selber getroffen, das gilt übrigens auch für die anderen Figuren aus den beiden Büchern von Elisabeth Schulz-Semrau und für den Krimi von Heiner Rank. Und vielleicht haben Sie ja tatsächlich mal von diesem Film „Meineid auf Ehrenwort“ gehört? Vielleicht war ja doch nicht alles erfunden, wie der Autor behauptet?
Auf jeden Fall aber viel Vergnügen beim Aussuchen und beim Lesen, weiter eine gute, gesunde und Corona-freie Zeit und einen schönen Übergang in den August-Sommer und bis demnächst.
EDITION digital war vor 25 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.000 Titel. Alle Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()