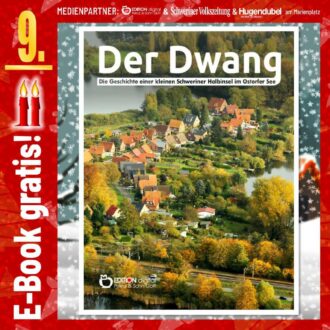Sozialistischer Zitronenhandel, eine Schwangere im Schlauchboot und fast eine Gotteslästerung – Fünf E-Books von Freitag bis Freitag zum Sonderpreis
Im Moment wird bekanntlich viel und zu Recht darüber diskutiert und debattiert, ob denn die Bezeichnung Mohr überhaupt noch verwendet werden darf. In diesem Falle aber heißt der Autor tatsächlich so – Steffen Mohr nämlich. Und darum darf auch sein Buch „Mo(h)ritaten“ heißen. Es enthält Lieder eines Galgenvogels und andere schwarze Gesänge, wofür der Galgenvogel zu DDR-Zeiten allerdings mehrfach mit Auftrittsverboten belegt wurde. Zensur ging eben auch anders.
Eine Dokumentation der etwas anderen Art hat Dietrich Biewald mit seiner Kollektion „Pioniere der 8. Mot.-Schützendivision der NVA im Bild. Eine Sammlung privater Fotos aus dem Besitz ehemaliger Angehöriger der 8. MSD“ vorgelegt, mit der er sein Buch über die „Pioniere in der 8. Motorisierten Schützendivision der NVA der DDR“ ergänzt.
Wer kennt eigentlich noch Georg Weerth? In seinem Buch „Und wen der Teufel nicht peinigt …“ macht Walter Baumert mit der Jugend dieses kämpferischen Dichters bekannt, als hätte es Georg Weerth selbst geschrieben. Empfehlenswert, auch oder gerade wenn man mit dem Namen dieses Schriftstellers auf den ersten Blick nicht viel anfangen kann.
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Und da hat die Literatur schon immer ein gewichtiges Wort mitzureden und heute erst recht. Eines der besten Motive, Umwelt und Natur zu schützen ist es, sie aktiv und genau kennen – und in diesem Sinne auch lieben zu lernen. Denn wer ihre Schönheit und ihre wichtige Funktion im Weltgetriebe kennt und auch über die Stellung des Menschen im ökologischen Gesamtsystem Bescheid weiß, der wird Natur und Umwelt achten, bewahren und folgerichtig beschützen wollen. In dieser Woche folgt ein hervorragendes Beispiel für solcherart Tierbeobachtungen, wobei besonders wichtig ist, dass der Autor nicht nur darüber geschrieben, sondern auch die wunderbaren Tierfotografien geliefert hat.
Erstmals 1987 veröffentlichte Wolf Spillner im Kinderbuchverlag Berlin „Zwischen Alpen und Eismeer. Begegnungen mit Tieren“: Über sich selbst erzählt der Autor Folgendes: „Seit jenem regennassen Herbsttag, an dem ich als 13-Jähriger die Lachmöwe in den Harzbergen fand, wollte ich wissen, wie Vögel und andere Tiere in ihrer Umwelt leben. Dazu nutzte ich immer wieder meine Freizeit. Um ihnen nahe zu sein, verbarg ich mich unter der Tarnkappe eines Versteckzeltes auf Bäumen und im Sumpf. Mit dem Auge der Kamera habe ich über viele Jahre versucht, ihr Verhalten in fotografischen Bildern auch für andere sichtbar zu machen. Manchmal ist es gelungen. Dafür bin ich gewandert, geklettert und weit gefahren, habe geschwitzt und sehr viel mehr noch gefroren. In den Stunden der Beobachtungen, die zu Wochen, Monaten und Jahren wurden, fand ich ein paar Körnchen an neuem Wissen. So führte die kindliche Neugier und die Freude an eigenen Entdeckungen von der toten Lachmöwe am Hang auf manchem Umweg zu meinem ersten Buch vom „Wald der großen Vögel“. Darin beschrieb ich, was mir nach dreijähriger Beobachtung bei Graureihern, Mäusebussard und Habicht aufgefallen war. Andere Bücher folgten, und den Büchern folgten Einladungen, auch in anderen Ländern Tiere zu beobachten und zu fotografieren. Auge in Auge mit den frei lebenden Tieren zu sein, von denen manche bedroht und gefährdet sind, wurde so zu einem Teil meiner Arbeit. Und schließlich kam ich zu jenen Vögeln im hohen Norden, von denen ich als Junge geträumt hatte. Ich traf auch andere Tiere, von denen ich damals noch nichts wusste. Von diesen Begegnungen will ich hier berichten.“ Dazu ein Beispiel, das wir hier aus guten Gründen in voller Länge präsentieren:
„Kleine graue Möwe
Mein Arbeitstisch steht am Fenster. Das ist ein großer Vorteil. Ich sehe viel Schönes. Bisweilen kann das ein Nachteil für die Arbeit sein.
Von der Schreibmaschine kann ich über die Gartenwiese und über Felder und Viehweiden hinweg, hinter Kopfpappeln und Hecken aus Schlehdorn, das Wasser und die Schilfwälder vom See beobachten. Der See ist ein reiches Naturschutzgebiet in Mecklenburg. Sobald ich das Fenster öffne, bringt mir mein starkes Fernrohr Einzelheiten von dort zum Greifen nahe. Es ist sehr verlockend, durch das Fernrohr zu äugen!
Im späten September warte ich von Tag zu Tag auf die Scharen der Bless- und Saatgänse, die aus dem Norden zu uns kommen. Ein paar Tausend fallen am Abend keifend und kakelnd auf dem Wasser ein. Im Winter achte ich auf die Bussarde, die Kolkraben und Seeadler. Ihnen habe ich einen Luderplatz auf der Viehkoppel am Seeufer angelegt. Da streiten sie sich um ein Schwein, das ich dorthin geschleppt habe. Im Sommer sehe ich die Fischadler über dem Wasser kreisen. Im Sturzflug stoßen sie nach Schleien und Karauschen. Dann leuchten zwischen den Schilfwäldern die silbernen Hälse der Graureiher über dem Flachwasser, und der Wind trägt mir die Flötenrufe von Brachvögeln und Wasserläufern durchs offene Fenster an den Schreibplatz. Manchmal ist es wirklich schwer, an der Schreibmaschine sitzen zu bleiben!
Aufregend, richtig aufregend ist das Frühjahr. An unseren flachen Sumpfsee kehren so viele Vögel aus dem Süden zurück. Sie sind hier zu Hause. Erst kommen die Graugänse, ihnen folgen verschiedene Entenarten, und bald danach vernehme ich das Quieken und Brüllen der Rothalstaucher und das Lärmen der Lachmöwen, die ihre Brutkolonien gründen. Über dem noch wintergelben Schilf gaukeln jauchzend die Rohrweihen. Dazu klingen die ersten gespenstischen Töne der Rotbauchunken aus dem Wasser vor dem Moorwald, während wir im Dorf den ersten Kuckucksruf erhoffen. Das Storchenpaar hat dann schon sein Nest auf dem hohen Dreibock bezogen und klappert laut über Gärten und Felder.
In dieser Zeit warte ich Jahr um Jahr auf die „lütt grise Mew“. Mehr als sonst sehe ich aus dem Fenster, suche mit dem Fernglas die Uferkanten ab, und so oft wie nur möglich bin ich am See, um ihre Rückkehr nicht zu versäumen.
Lütt grise Mew, mit dieser Bezeichnung kann nichts anfangen, wer kein Plattdeutsch versteht. Kleine graue Möwe also. Es ist ein schöner Name. Er sagt viel und führt nicht so in die Irre wie der richtige Name des Vogels, Trauerseeschwalbe. Mit Schwalben nämlich hat der amselgroße Vogel außer dem gegabelten Schwanz gar nichts gemein. Mit Möwen aber ist die Trauerseeschwalbe ebenso verwandt wie die beiden anderen europäischen dunklen Seeschwalben, die Weißbart- und die Weißflügelseeschwalbe. Sie allerdings ziehen Südeuropa als Heimat vor und kommen nur selten und niemals zur Brut in unsere Breiten.
Die Trauerseeschwalbe ist eine Sumpfseeschwalbe. Sie baut ihre kunstlosen Nester auf treibenden Pflanzenteppichen über dem Flachwasser, nistet auf Rohrstoppeln und Schlammbänken, auf kleinen Pflanzenkaupen. Und stets finden sich mehrere Paare nahe beieinander zum Nisten ein. Sie sind Koloniebrüter wie ihre anderen Möwenverwandten. Noch zu Beginn unseres Jahrhunderts waren Trauerseeschwalben zwar keine häufigen, aber noch keine seltenen Vögel in Mitteleuropa. Jetzt zählen sie in den Industrieländern zu den arg gefährdeten Arten der Sumpf- und Wasservögel. Die meisten ihrer ehemaligen Brutvorkommen sind erloschen. Durch menschliche Besiedlung, durch Industrie und intensiv betriebene Landwirtschaft gingen den Vögeln die Lebensräume verloren. Nur in Naturschutzgebieten sind größere Kolonien verschont geblieben. Unser See zwischen den Feldern und Dörfern in Mecklenburg ist eine solche Ausnahme. Jahr für Jahr bietet er rund fünfzig Paaren eine sichere Brutheimat. Damit wurde er weit über die Grenzen unseres Landes bekannt.
Meine ersten Trauerseeschwalben sah ich als Schuljunge in Hamburg. Damals gab es zwischen den Elbströmen der Stadt noch Wiesen und Weiden, von Gräben durchzogenes flaches grünes Land. Hinter den Deichen grasten schwarz-weiße Rinder, und das Wasser der Wiesentümpel war von dichten Teppichen der weiß blühenden Krebsschere bedeckt. Darauf nisteten Trauerseeschwalben. Sie flatterten und schwebten und landeten rasch wieder auf ihren Nestern, als ich mich im Binsengestrüpp verkroch. Ich hatte die erste Vogelkolonie meines Lebens gefunden, und das war eine große Entdeckung für mich.
Ich lag lange in den Binsen, und ich bekam einen nassen Bauch dabei. Aber das störte mich nicht. Ich sah doch, wie die Vögel auf ihren Nestern saßen, wie sie brüteten und sich ablösten, und auf einem der acht Nester, die aus ein paar feuchten Pflanzenblättern zusammengezogen waren, gierten drei winzige Dunenjunge unter dem Gefieder des Altvogels hervor, als eine zweite Seeschwalbe am Nest landete. Sie brachte silbern glänzende Beute im Schnabel, die das größte Junge sofort verschluckte. Es war wohl ein Fischchen. Sehr deutlich konnte ich das nicht erkennen, denn die Nester waren zwanzig Meter weit entfernt, und ein Fernglas besaß ich nicht. Die Jungvögel sahen wie kleine Wollknäuel aus, graugelb und dunkel gefleckt. Ich musste sie unbedingt aus der Nähe betrachten! So zog ich mich aus und watete in das flache Wasser. Die Krebsschere zerstach und zerkratzte mir die nackten Beine. Über mir flatterten die Seeschwalben und stießen mit schrillen Schreien im Sturzflug herab. Die Luft unter ihren schmalen, gewinkelten Schwingen pfiff, ihre Schnäbel streiften mein Haar, und ich zog ängstlich den Kopf ein. Aber als ich zu den Nestern kam, fand ich nur die schönen tarnfarbenen Eier. Die jungen Trauerseeschwalben hatten ihr Nest verlassen und waren unsichtbar für mich. Über mir zeterten die Altvögel, und ich watete wieder aus der Kolonie heraus, um nicht noch mehr zu stören. Schon damals habe ich sehr bedauert, dass man sich nicht unsichtbar machen kann. Zu gern hätte ich aus der Nähe gesehen, wie die Seeschwalben ihre Kinder füttern.“ Und damit zu den ausführlicheren Präsentationen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters:
Unter dem schönen Titel „Die singende Lokomotive“ erschienen erstmals 1974 im Eulenspiegel Verlag Berlin 25 Kurzgeschichten von C. U. Wiesner: Ein unglücklich verliebter junger Mann verabredet sich mit der Dame seines Herzens zum Schlittschuhlaufen, obwohl er noch nie solche Eisen unter den Sohlen gehabt hat. Ein paar neunmalkluge Männer machen eine bahnbrechende Erfindung, mit der man sich das Rauchen abgewöhnen könnte. In Leipzig, vor der Thomaskirche, steigt Johann Sebastian Bach von seinem Sockel, um mit ein paar Musikstudenten nächtlicherweile zu jazzen. In 25 Kurzgeschichten, zuvor schon in der Zeitschrift Eulenspiegel veröffentlicht, geschehen komische, skurrile, alberne und abgründige Dinge. Noch viel später wunderte sich der Autor, dass solche Texte wie Zitronen aus Kummersbach oder Spuk auf der Lichtung dem Zensor durch die Lappen gingen.
Die verschwundene Partitur wurde übrigens zum Grundstoff für ein gleichnamiges Musical, das 1976 in Halle seine Uraufführung erlebte. Und um sich mal selbst ein Bild machen zu können, was damals dem Zensor durch die Lappen ging, hier einer der entsprechenden Belege:
„Zitronen aus Kummersbach
Ich setzte mich an seinen Tisch. Er trank Kognak und machte vor mir kein Hehl daraus, dass er Prebusch sei. Der Direktor der Kummersbacher Konservenfabrik „Lucas Cranach“. Ich hatte den Namen schon mal gelesen und ihn mir gut eingeprägt. Er stand auf dem Etikett eines Mischgemüseglases, und der Deckel war so stark angerostet gewesen, dass ich alle herkömmlichen Öffnungsversuche aufgegeben und zu einem Hammer gegriffen hatte, worauf wir an jenem Sonntag auf die Gemüsebeilage verzichten mussten. „Lucas Cranach“, sagte ich sinnend. „Wie sind Sie bloß auf diesen Namen gekommen?“ – „Weil“, entgegnete Prebusch stolz, „unser Gemüse in den Gläsern wie gemalt aussieht.“ – „Exportieren Sie auch?“, fragte ich, nur um etwas zu sagen. Aber damit hatte ich vielleicht ein Fass angestochen! Und das lief nun aus bis zum letzten Tropfen.
„Sie sind ein Mensch“, sagte Prebusch und bestellte zwei Doppelte. „Sie werden das verstehen. Simmer doch mal ehrlich: Was verlangt man von uns Leitern? Eigeninitiative. Und wie sieht’s aus?“ Er ließ den Kopf sinken und schnaufte. „Prognose, nicht wahr? Vergleiche mit dem Weltstand. Man muss doch an später denken. Hab’ ich recht?“ Ich konnte das nur bestätigen und meinte versöhnlich, er solle sich man keine grauen Haare wachsen lassen, Gemüse würden die Leute immer gern essen, ohne es selber zu putzen. Prebusch schien enttäuscht. „Gemüse“, murmelte er verächtlich. „Jedes Dorf baut Gemüse an. Und wo liegt die Perspektive? Na? Na?“
Ich dachte still an Spargel oder Teltower Rübchen. Aber da beugte sich Prebusch über den Tisch, kniff ein Auge zusammen und sagte im Verschwörerton: „Zi-tro-nen. Kapiert? Nein, gar nichts kapiernse. Also: Zu meinem Werk gehört ein Forschungstreibhaus, und da lasse ich schon seit zehn Jahren Zitronen züchten. Nu sindse sprachlos. Die Erfolge bestätigen die Richtigkeit unseres Weges. In diesem Jahr hatten wir eine Rekordernte: Dreikommafünf Kilogramm.“ – „Richtige Zitronen?“, erkundigte ich mich verwundert.
Mein zweifelnder Ton schien ihn zu ärgern. „Denkense etwa, aus Pappmaschee? Nun ja, es ist nicht die ordinäre handelsübliche Form. Die Cranachzitrone wird etwa taubeneigroß, aber ein Aroma, sag ich Ihnen!“ Er schnalzte überwältigt mit der Zunge. „Ein interessantes Hobby“, warf ich ein. Prebusch musterte mich verstört und sagte tonlos: „Das ist es eben. Keiner sieht die Perspektiven. Simmer doch mal ehrlich: Wie viel Devisen wirft der Staat jährlich aus dem Fenster, um Zitronen zu importieren? Dabei könnten wir mit meinen Früchtchen nicht nur den Binnenmarkt versorgen, sondern durch einen groß angelegten Export wertvolle Devisen hereinbringen. Nu sindse platt, was?“
Das stimmte. Aber ich hegte leise Bedenken. „Herr Prebusch, wie wollen Sie mit dreieinhalb Kilo …“ – Er lächelte überlegen. „Sind Sie doch nicht kindisch. Die Pläne für eine Kapazitätserweiterung liegen hier.“ Er klopfte auf seine Brusttasche und deutete zum Fenster, wo man aber nichts sah, weil es dunkel war und schneite. „Da drüben, der Mühlnickelberg wird abgeholzt. Auf den Südhang kommen vierzehn Hektar Treibhäuser hin, dazu auf den Nordhang ein Fernheizwerk, und dann können wir jährlich …“ – „Moment mal! Und wo kommen die Gelder für diese gigantische Investition her?“ – Prebusch nickte anerkennend. „Das ist eine gute Frage. Man kann sie nicht unverhallt im Raum stehen lassen. Die Industrie- und Handelsbank wird einen Kredit ausspucken müssen, auch wenn mir der Bezirk noch immer Knüppel zwischen die Bäumchen wirft. Aber da kennense Prebusch schlecht! Der geht bis zum Staatsrat!“ – „Ich bewundere Ihre Energie, aber wäre denn die Sache mit den Zitronen für unsere Wirtschaft überhaupt rentabel?“
„Lieber junger Freund“, sagte Prebusch würdevoll und musste husten, weil er den Kognak zu hastig getrunken hatte. „Sie sehn die Dinge zu eng. Wir brauchen Devisen, und darum müssen wir mit dem Zitronengeschäft Furore auf dem Weltmarkt machen.“ – „Meinen Sie, dass wir da eine Chance hätten?“ – Er betrachtete mich fast mitleidig. „Sie sind ein Mensch, der seinen Zitronensaft trinkt, ohne sich Gedanken über die internationale Marktlage zu machen.“ Ich räumte das freimütig ein.
Prebusch klopfte abermals auf seine Brusttasche. „Hier liegen meine Vergleichsanalysen mit dem Weltstand. Es gibt einundneunzig Länder, denen wir – wenn ich mal im Sinne des VEB ,Lucas Cranach‘ pars pro domo sprechen darf – in der Zitronenproduktion heute schon meilenweit voraus sind. Genaueres werden wir wissen, wenn man mir erst meine internationale Studienreise genehmigt hat.“ – „Wo soll’s denn hingehn?“, erkundigte ich mich. – „Ich dachte an die Nordroute“, erwiderte er, „Skandinavien, Großbritannien, Grönland – stellnse sich vor, die müssen -“, er hatte Mühe, ein triumphierendes Kichern zu unterdrücken, „die müssen die Zitronen momentan sogar aus Italien importieren. Tja, und dann geht’s über Alaska und Sibirien zurück und gleich ’ran an das große Werk.“
Ich überlegte angestrengt. „Na schön, aber wie wollen Sie in diesen Ländern die Vormacht der italienischen Importeure brechen?“ – „Alles bedacht, alles bedacht“, entgegnete Prebusch geschäftig, „wir müssen unsere Zitronen eben billiger verkaufen.“ – „Ja, aber die Produktion stellt sich doch in unseren nördlichen Breiten viel teurer als in Italien.“ – „Na und?“ Prebusch war nicht in Verlegenheit zu bringen. „Wir bekommen einen Kredit in unserer Währung und – verstehnse mich recht – zahlen ihn in baren Devisen zurück. Gut, was?“
Begriffsstutzig schüttelte ich den Kopf. „Aber die Deviseneinnahme ist doch viel kleiner als …“ – „Sie begreifen gar nichts. Dafür sind ja unsere Zitronen auch kleiner.“ Sein Gesicht erhellte sich. „Jetzt fällt bei Ihnen endlich der Groschen. Weil sie kleiner sind, müssen wir sie billiger verkaufen, und da liegt doch grade die Exportchance. Was meinen Sie, was unser Staat für Devisen alles einführen kann?“ – „Zitronen beispielsweise“, sagte ich und winkte den Ober zum Zahlen heran. „Falls doch mal jemand das Kummersbacher Aroma nicht vertragen kann.“
Als ich in meinem klammen Hotelbett lag, erschien mir Prebusch im Traum; er hatte vergessen, mir noch was Wichtiges zu sagen: „Simmer doch mal ehrlich: Der VEB ,Lucas Cranach‘ stützt sich natürlich auf Erfahrungen. Da gibt’s doch genug andere Exportbetriebe, die schon mit Zitronen gehandelt haben.“
„Da hamse auch wieder recht“, murmelte ich schläfrig, indes die Kummersbacher Rathausuhr Mitternacht schlug.“
Erstmals 1996 veröffentlichte Steffen Mohr in der Leipziger Kommissions- und Großbuchhandelsgesellschaft seine „Mo(h)ritaten. Lieder eines Galgenvogels und andere schwarze Gesänge“: Der Töterich wütet auf Wunsch, natürlich im Knöterich. Ein Mordanschlag trifft nicht den ungetreuen Musiker, sondern dessen Liebchen. Die Radeltour hat ein erotisches finish. Und gegen das Banküberfallunwesen hilft nur eins: Schwere Jungen muss man küssen … Als Kabarettist und Gitarrenschläger hat sich Steffen Mohr in den Jahrzehnten seiner Auftritte Freunde gewonnen, die – wie er – schwarzen Jux und grünen Humor lieben. Ein dunkler Charakter offenbart hier seine heitere Seite. Die Nähe zu Wilhelm Buschs Spruchweisheit und Christian Morgensterns hintergründigem Spaß ist in den Liedern dieses Galgenvogels unverkennbar. Steffen Mohr hat die Texte seiner erfolgreichen kabarettistischen Auftritte seit den 1980er Jahren in diesem Buch veröffentlicht. Seine satirischen Texte brachten ihm in der DDR drei Auftrittsverbote ein. Sie handeln von Gott und der Welt. In humorvollen Liedern übt er Kritik an der DDR, wie Wohnungsfragen, fehlende Baukapazitäten (wenn doch Erich mich mal besuchte und mein Dach decken würde), nicht beantwortete Eingaben u. a. Breiten Raum nehmen die Probleme der Nachwendezeit und der Gegenwart ein. Dazu kommen blutrünstige Mordgesänge, Lieder über Bankräuber und andere Galgenlieder. Am Ende ist jeweils die zugehörige Melodie angeführt, Nachsingen ist erwünscht. Und dem ist nicht viel hinzuzufügen:
„Galgenvogels Mondgesang
Lob des Würgers oder: Von Trost und Nutzen der Trivialpoesie
Die Stadt steht unter Denkmalschutz, denn Goethe wohnte hier
und neben Johann Wolfgang noch so manches hohe Tier.
Drum stecken wir Asylbewerber in den Plattenbau.
Wenn dort mal so ein Bömbchen trifft, trifft’s ja nicht Kunst am Bau!
Der Horror im Leben ist unbeschreiblich,
darum liest man Horrorpoesie.
Denn der Würger würgt nur neunmal,
doch der deutsche Gruselalltag endet nie!
Ein festes Seil verbindet uns, mit Präzision gedreht,
an dessen Anfang Kaiser Friedrich, am End’ man selber steht.
Die deutsche Seilschaft hielt das Morden schon immer für normal!
Und wer sich’s selbst nicht zutraut, liest King und Roald Dahl!
Der Horror im Leben ist unbeschreiblich,
darum liest man Horrorpoesie.
Denn der Würger würgt nur neunmal,
doch der deutsche Gruselalltag endet nie!
Ein Goethe in der Tasche beim Gang zum Arbeitsamt,
wo man sitzt und wartet, zum Lächelkrampf verdammt?
Ob Arbeits-, ob Sozialamt, Steuer – die Folter ist perfekt!
Dort hilft ein Blut- und Schauerbuch, das tröstlich uns erschreckt!
Der Horror im Leben ist unbeschreiblich,
darum liest man Horrorpoesie.
Denn der Würger würgt nur neunmal,
der deutsche Gruselalltag aber endet nie!
Weise: Columbus hat die Welt entdeckt /
Refrain: ln der Heimat gibt’s ein Wiederseh’n
Lied eines Galgenvogels
Der Mond ist aufgegangen.
Ich hab mich aufgehangen
und schaukle still im Sturm.
Vorbei sind alle Leiden.
In meinen Eingeweiden
schmatzt mit Genuss der Totenwurm.
Wie war ich voll Furore
für meine Leonore,
besprang sie Nacht für Nacht!
Sie mochte mein Bespringen.
Aus meines Herzens Singen
hat sie sich leider nichts gemacht.
An einem Abend stille
war ich ihr nicht zu Wille
und sprach: „Dein Herz mir schenk!“
Da wandt sie sich mit Grausen,
tat zu Hans-Peter sausen,
rieb mit ihm Knie an Kniegelenk.
Jetzt habe ich Musike –
wie ich im Wind mich wiege,
Musike schwer und leis.
Lenore fehlt ein bisschen.
Vor allem ihre Küsschen.
Da wird mein wurmzerfressner Mund ganz heiß.
Weise: Der Mond ist aufgegangen
Der Hochwassertourist
Frühmorgens stelle ich das Radio an.
In Indien ertranken wieder tausend Mann.
Das geilt mich zwar auf, doch das Land ist zu weit.
Auch versteh ich kein Englisch – höchstens, wenn man
HELP ME schreit.
Mich reizen Geschichten direkt vor Ort.
Denn wenn ein Landsmann klagt, versteh ich jedes Wort.
Sein Gejammer beflügelt meinen Sinn!
Wenn der Rhein übertritt, fahr’ ich auf Urlaub hin!
Mir hängt der Himmel voller Geigen,
wenn ringsumher die Fluten steigen!
Wenn’s unten schwillt und oben gießt!
Ich bin der Hochwassertourist.
Es ist absolut toll, in wasserdichten Schuh’n
einen Blick in überschwemmte Wohnzimmer zu tun.
Das Heulen einer Schwangeren im Schlauchboot zu entdecken
und ’nem völlig nassen Helfer schnell zehn Mark zuzustecken.
Ich liebe das Wasser. Ich liebe den Rhein!
Und wenn er wieder steigt, reich ich Urlaub ein.
In Gummistiefeln und das Video schussbereit
genieß ich das Gefühl der Barmherzigkeit!
Mir hängt der Himmel voller Geigen,
wenn ringsumher die Fluten steigen!
Wenn’s unten schwillt und oben gießt!
Ich bin der Hochwassertourist.
Weise: Rock-Phasen / Refrain: Oh Baby balla-balla“
Als Eigenproduktion von EDITION digital erschien 2016 „Pioniere der 8. Mot.-Schützendivision der NVA im Bild. Eine Sammlung privater Fotos aus dem Besitz ehemaliger Angehöriger der 8. MSD“ von Dietrich Biewald. Über Hintergründe und Anliegen dieser Ausgabe informiert ein Geleitwort:
„Diese Bildersammlung mit Ausschnitten aus dem Dienst der Pioniere in der 8. Motorisierten Schützendivision ist zunächst einmal als ein fotografischer Nachweis über den Dienst in den Pioniereinheiten der Division gedacht. Er besteht fast nur aus Amateuraufnahmen, die dankenswerterweise von einer Vielzahl ehemaliger Angehöriger der 8. MSD bereitgestellt werden konnten. Sie soll aber auch als Ergänzung zum Buch über die „Pioniere in der 8. Motorisierten Schützendivision der NVA der DDR“ dienen. Insofern sei daher an dieser Stelle darauf verwiesen, dass es sich um keine umfassende Darstellung handeln kann. Insbesondere hinsichtlich einiger Truppenpioniere aber auch über bestimmte Zeiträume hinweg zeigen sich auf diese Weise einige „weiße Flecken“. So entstanden zwangsläufig Lücken in der Chronologie, die indes durch die große Zahl der angebotenen Bilder das eine oder andere Mal etwas kompensiert werden können. Diese Hoffnung wird zumindest damit verknüpft. Viele der ehemaligen Pioniere verfügten nur über wenige Fotos aus der Dienstzeit, manche über gar keine. Für den einen oder anderen kann diese Bildersammlung vielleicht nachträglich ein bisher fehlendes Album über die Dienstzeit ersetzen.
Diese Zusammenfassung von fast 900 Abbildungen wird darum bewusst sparsam mit Texten unterlegt. Ich wünsche mir, dass all jene, die sich diese Bilder immer wieder einmal betrachten, sich an eigene Erlebnisse aus ihrer Dienstzeit bzw. an die ihrer in den Pioniereinheiten gedienten Angehörigen, Freunde etc. erinnern, an Anstrengungen, an Leistungen die sie bzw. ihre Einheiten vollbrachten, vielleicht an manchen Ärger, den dieser Dienst mit sich brachte, aber auch an Kameradschaft und an freudige Stunden. Alle, auch jene, die nicht in den Pioniereinheiten Dienst versahen, bitte ich beim Betrachten der Fotos zu berücksichtigen, dass es sich vorwiegend um Amateurfotos handelt. Auch sollte man nicht unerwähnt lassen, um welche Zeit es geht und dass all jene, die im Bild zu sehen sind, nicht die großen Befehlsgeber waren, sondern inmitten ihrer Truppenteile und Einheiten Aufgaben zu erfüllen hatten, welche stets unter der Prämisse der Sicherung des Friedens standen. All jene, die ihren Dienst auf dieser Grundlage absolvierten, schauen noch heute zu Recht mit Stolz darauf zurück. Sie haben nicht vergessen, dass auch mit ihrer Hilfe der Kalte Krieg nicht zu einem heißen werden konnte.
Dass diese Bildersammlung überhaupt entstehen konnte, verdanke ich insbesondere den Angehörigen der Pionierkameradschaft Schwerin, allen voran dem Vorsitzenden Jochen Schmidt, der das eine oder andere in Bewegung setzte und manches erst ermöglichte. So kam es, dass viele fleißig in ihren alten Fotoalben wühlten, die Bilder auswählten oder ihre Alben komplett zum Scannen zur Verfügung stellten.
Jedoch auch ehemalige „Nichtpioniere“ steuerten einige ihrer alten Fotografien bei. Pioniere agierten ja nicht im luftleeren Raum. Ihre Hauptaufgabe bestand nun einmal in der Pioniersicherstellung der Handlungen der Truppenteile und Einheiten der Division. Viele der vorliegenden Aufnahmen zeigen daher das Zusammenwirken der Pioniere mit den anderen Waffengattungen, Spezialtruppen und Diensten. Darum kann dieser Bildband sicherlich auch einiges an Interesse bei den „Ehemaligen“ aus all diesen Bereichen wecken.“
Erstmals 1975 veröffentlichte Walter Baumert im Kinderbuchverlag Berlin sein Buch über die Jugend des Dichters Georg Weerth „Und wen der Teufel nicht peinigt …“. Die reichlich verwandten Zitate aus Georg Weerths Lyrik, aus seinen Prosaarbeiten und seinen Briefen sind den von Bruno Kaiser 1956/57 im Aufbau-Verlag Berlin erstmals herausgegebenen Sämtlichen Werken Georg Weerths in fünf Bänden entnommen: Nehmt eine Wegstrecke, die ihr mit gutem Schuhwerk zwischen Frühstück und Mittagessen durchwandern könnt, also etwa fünf deutsche Landmeilen, einmal in der Länge und einmal in der Breite, setzt eine verschlafene Kleinstadt hinein mit knapp fünftausend evangelisch getauften Seelen, mit einem richtigen Schloss, einer Post, mehreren Kirchen, zwei Schulen und einer Handvoll prächtig herausgeputzter Soldaten – dann habt ihr das Fürstentum Lippe-Detmold, mein Vaterland. Mit diesen Worten beginnt die Erzählung über Kindheit und Jugend des Dichters Georg Weerth, von Walter Baumert so berichtet, als hätte sie der Dichter selbst geschrieben: ironisch, spritzig und engagiert. So ist ein Buch entstanden, das Weerths Dichtung wie auch ein Stückchen Vormärz-Zeit neu entdeckt. Hier ein kurzer Ausschnitt, in dem Baumert/Weerth über eine Begegnung berichtet, die seiner Mutter fast wie eine Gotteslästerung vorkommt:
„Ich sehe den Dichter Grabbe und verliere meinen Lehrer
Auf einer unserer Exkursionen in die dunklen tiefen Schluchten des heimatlichen Waldes begegnete uns ein merkwürdiger bleicher Mann mit einem vogelartigen Kopf und schütterem fahlgelbem Haar auf der mächtigen Stirn, der, tief in Gedanken versunken, mit finsterem Gesicht auf uns zukam. Ich verkroch mich ängstlich hinter die Rockschöße meines Lehrers, der zur Seite getreten war, den Hut in der Hand hielt und sich tief vor dem unheimlichen Wanderer verbeugte, ohne auch nur eines Blickes gewürdigt zu werden.
„Wer war das?“, fragte ich, während ich noch gebannt auf die Stelle im Wald starrte, wo der Finstere verschwunden war.
Ehrfurchtsvoll antwortete mir Papa Freiligrath: „Das war Grabbe. Der arme, unglückselige Grabbe. Ein dramatischer Dichter, eine geniale Begabung, die größte, die einzige, die unser Ländchen hervorgebracht hat. Draußen in der Welt hat er viele Bewunderer seiner Werke. Aber die beschränkten Kleinbürger und Philister seiner Heimatstadt verachten ihn, reißen die dümmsten Witze über ihn, lachen ihn aus, verspotten ihn, weil er aus armen Verhältnissen stammt und es nicht wie ein Bierhändler oder Schweinemeister zu Wohlstand und Besitztum gebracht hat. Hätte er nicht in dem Herrn Archivrat Klostermeyer den einzigen Menschen gefunden, der sein Genie erkannte und ihm eine Stellung als Auditeur verschaffte, gewiss hätten sie ihn elendiglich verhungern lassen. Ach, diese verlogenen, engstirnigen Krämerseelen! So klein und erbärmlich ihr Land ist, so kleinlich und gehässig ist auch ihre Seele. Wäre er doch draußen in der Welt geblieben, nie zurückgekehrt zu seiner geliebten Mutter! Wäre er doch in ein Land gezogen, wo den Dichtern, den erhabenen Schöpfergenien des Volkes Ehrerbietung, Verständnis und Liebe entgegengebracht werden! Hier wird er zugrunde gehen!“
Ich deutelte lange an dem herum, was mir Papa Freiligrath da alles erzählte von diesem finsteren Mann. Schließlich sagte ich: „Vielleicht brauchen wir keinen Dichter. Es stehen doch schon so viele Bücher bei Onkel Klostermeyer.“
Papa Freiligrath lächelte. ,,Es kann gar nicht genug Bücher geben, Georg. Denn sie sind die unersetzlichen Wissensquellen und Wegweiser des Menschengeschlechts. Freilich nur für die, die sie lesen. Was wären wir Menschen viel mehr als umhertappende Tiere, begrenzt auf unser bisschen eigene Anschauung und Erfahrung, würden nicht Gelehrte und Dichter, Forscher und Künstler uns in ihren Büchern den Blick öffnen auf den Reichtum der ganzen Welt, auf die geistigen Strömungen der Jahrhunderte, auf die Geschichte ganzer Völker und auf die Erkenntnis unserer eigenen Seele?“
„Aber dein Sohn, ist er nicht auch ein Dichter?“, fragte ich.
Papa Freiligrath lächelte. „Gott gebe es, mein Kind, dass ihm dereinst etwas Großes gelingen möge!“
„Hast du ihn deswegen in die Welt hinausgeschickt?“
Der gute Herr sah mich an, wollte erst wieder lächeln, aber dann streichelte er meinen Kopf und sagte ganz ernsthaft: „Ja, vielleicht deswegen. Und hätte ich drei Söhne, mit guten Anlagen wie Ferdi, ich würde sie alle hinausschicken, damit ihre Seele nicht verkümmere in einer Stadt, die den Geist missachtet und alles Große, Neue und Unbekannte mit Misstrauen und Hass verfolgt.“
In tiefes Nachdenken versunken, kam ich zu Hause an. Ich sah meinen Vater, meine großen Geschwister, die harmlos vergnügt am Tisch saßen. Es fiel mir ein, dass auch meine Mutter des Öfteren ihre Unzufriedenheit über die Enge unserer Stadt geäußert hatte. Und ich begann, alles das, was ich bis jetzt erlebt hatte, mit neuen Augen zu betrachten.
Als Mama mich vor dem Schlafengehen examinierte, nach meinen Fortschritten im Lateinischen und in den Bibeltexten befragte, schüttelte ich den Kopf und erklärte in aller Entschiedenheit: „Ich will nicht Geistlicher werden wie Papa und Onkel Roß. Ich will Dichter werden und Bücher schreiben. Ein Dichter wie Grabbe!“
Bei dem Namen Grabbe war meine Mutter entsetzt aufgesprungen, als hätte ich die schrecklichste Gotteslästerung ausgesprochen. Oh, ich erinnere mich genau dieser Szene.
„Um Himmels willen, Georg, mein Söhnchen, wie kommst du auf diesen tollen Einfall? Wie kommst du auf diesen Namen?“
Ich berichtete von unserer Begegnung.
Da wurde Mama plötzlich ganz besorgt und närrisch, als wenn sie einen Schwerkranken vor sich hätte. Sie nahm mich in die Arme, drückte mich betulich an ihren Busen, blickte mir in die Augen und beschwor mich: „Mein Kleiner, du wirst diesen Vorfall vergessen. Den Namen dieses haltlosen, verkommenen Menschen musst du gänzlich aus deinem Gedächtnis entfernen. Er war dereinst ein junger hoffnungsvoller Abiturient, dem alle zugetan waren und alle ein gesichertes Fortkommen als Beamter, Theologe oder Jurist herzlich gönnten. Dein Vater und andere vermögende Leute haben viel Geld drangewandt, um ihm ein sorgenfreies Studium zu ermöglichen. Er aber hat unser Vertrauen arg getäuscht. Statt sich seinen Studien zu widmen und so schnell wie möglich ein Examen abzulegen, hat er sich in zweifelhafte Abenteuer gestürzt und seine Mittel sinnlos verschleudert. Das, was dein Lehrer an ihm bewundert, sein literarisches Talent, der Drang zum Theater, zum sogenannten freien Künstlerleben, ist zu seinem Verhängnis geworden, hat sein Leben zerrissen, ihn zum bejammernswertesten Individuum gemacht, das man sich vorstellen kann.“
Ich blickte meine Mutter verständnislos an, glaubte ihr zum ersten Mal im Leben kein Wort.“
Und damit soll es für heute genug sein mit den diesmal recht unterschiedlichen Sonderangeboten dieser Woche. Auf diese Weise aber dürfte wohl für jeden Geschmack etwas dabei sein.
Viel Vergnügen beim Entdecken und beim Lesen, weiter eine gute, gesunde und Corona-freie Zeit sowie einen hoffentlich bald wieder richtig schön und heiß werdenden Sommer, in dem man auch mal wieder eine (Kummersbacher) Zitronenmischung oder ein weltmarktbeständiges Zitroneneis vertragen kann und bis demnächst.
EDITION digital war vor 25 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.000 Titel. Alle Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()