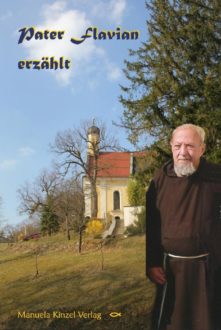Keine Lust auf Westgeld, Herausforderungen bei der Fahne sowie ein Auftrag für den Menzelzwerg – Fünf E-Books von Freitag bis Freitag zum Sonderpreis
Auch ein Blick in den Osten, allerdings in einen ganz besonderen Bereich der DDR, bietet der Roman „Harte Jahre“ von Jürgen Ritschel, der in der NVA spielt. Abiturient Rosenkranz muss zur Fahne und lernt dort eine ganz andere Welt kennen.
„Orbitale Balance“ lautet der Titel des zweiten Bandes seiner „Raumlotsen“-Tetralogie von Carlos Rasch. Er liefert astronautische Abenteuer.
In „Geisterstunde in Sanssouci. Bilder aus dem Leben Adolph Menzels“ lässt Renate Krüger einige der berühmtesten Bilder des kleinen-großen Malers zu Geschichten werden.
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Das heutige Angebot präsentiert einen berührenden Auszug aus dem langen Leben eines Jahrhundertzeugen, der tatsächlich fast 100 Jahre alt werden sollte, obwohl er als Jude geboren worden und aus diesem Grund vor allem während seiner Jugend großen, sogar tödlichen Bedrohungen ausgesetzt war. Dieses Buch zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie wichtig es ist, den Anfängen zu wehren – und zwar schon den gedanklichen Anfängen: Wo man Bücher verbrennt, da verbrennt man bald auch Menschen, hatte einst ein jüdischer Dichter hellsichtig und leider zu Recht gewarnt …
Erstmals 1982 veröffentlichte Walter Kaufmann in der EDITION HOLZ im Kinderbuchverlag Berlin „Kauf mir doch ein Krokodil. Geschichten“: Walter Kaufmann, der als fünfzehnjähriger jüdischer Junge mit viel Glück aus Deutschland entkommen konnte, während seine Adoptiveltern in Auschwitz ermordet wurden, hat viel zu erzählen – über die Suche nach seiner Herkunft und über das Schicksal seiner wirklichen Mutter, über die Zeit damals in Deutschland und später in Australien, über seine Reisen als Seemann auf DDR-Frachtschiffen und als Reporter in New York und London. Ein Leben unterwegs. Hier ein verhältnismäßig langer, aber sehr berührender Auszug vom Anfang dieses Buches, der auch eine Bemerkung des jungen Walter wiedergibt, die er sein Leben lang bereut hatte:
„Suche nach der Herkunft
Als ich acht Jahre alt war, geriet ich einmal mit unserer Hausgehilfin Hilde, die ich liebte, so sehr in Streit, dass sie schließlich rief: „Nun aber genug! Du hast mir überhaupt nichts zu sagen – Adoptivkind, du!“
Ich verstummte. Etwas Unheimliches lag in dem Wort, dessen Bedeutung ich nicht verstand. Ich bedrängte meine Eltern, die sich aber auf keine Erklärung einließen – „später, Junge, wenn du älter bist.“ Ihr Ausweichen stimmte mich nachdenklich, noch nachdenklicher machte mich, dass die Mutter von Ungehörigkeit, ja geradezu einer Anmaßung der Hausgehilfin sprach. Was konnte sie nur so aufgebracht haben?
Es dauerte eine Weile, bis ich mich beruhigt hatte und die Sache zu vergessen suchte. Fortan aber lag ein Schatten über meinem Verhältnis zu ihr – auch mein Verhältnis zu Hilde blieb getrübt, obwohl sie das Wort Adoptivkind in meinem Beisein nie wieder fallen ließ. Doch einmal vernommen, musste es jahrelang in mir nachgewirkt haben, denn als ich, fünfzehnjährig, mit einem Flüchtlingstransport jüdischer Kinder den Nazis entkommen konnte, sagte ich beim Abschied auf dem Bahnsteig zu meiner Mutter: „Brauchst nicht traurig sein – ich bin doch gar nicht dein Kind!“
Sie wird diese Worte bis zu ihrem tragischen Ende nicht verwunden haben – dabei wollte ich doch nur, dass sie meinen Verdacht endgültig beseitigt. Inzwischen aber weiß ich, dass sie das nicht konnte. Urkunden, die nach meiner Rückkehr aus der Emigration an mich gelangten, bestätigten, dass ich knapp drei Jahre nach meiner Geburt in Berlin von einem Ehepaar in Duisburg adoptiert worden bin.
„Ein Junge mit dem Namen hier in der Mulackstraße? Nicht dass ich wüsste!“ Der kleine Mann in Schiebermütze und Lederjacke, der sich als Alfons Hinze vorgestellt hatte, Angestellter in einer Zoohandlung am Alexanderplatz, beäugte mich misstrauisch. „Dabei hab ich mein Leben lang hier gewohnt.“
Nicht lang genug, sagte ich mir, zeigte aber doch auf das Haus, zu dem wir inzwischen gelangt waren – eine jener vielen Kriegsruinen, die es im fünfundfünfziger Jahr noch in Berlin gab. Nur der Keller des Hauses schien bewohnbar zu sein, schwaches rötliches Licht schimmerte durch den Vorhang eines der dicht über dem Bürgersteig liegenden Fenster.
„Dieses Haus war es wohl!“
„Muss vor meiner Zeit gewesen sein“, sagte Hinze. „Die da noch wohnt aber, wohnt da schon ewig – und kennt auch jeden. Fragen wir sie doch.“ Schon wollte er an die Scheibe klopfen, da besann er sich. „Sie wird Besuch haben“, sagte er.
Ich fragte, ob wir stören würden. Hinze nickte bedeutungsvoll. „Ist zwar nicht mehr die Jüngste, schafft aber noch immer an. Besser ist, wir warten.“
Nieselregen fiel. Mich fröstelte in der kalten Novembernacht und dem viel zu leichten, noch aus Sydney stammenden Mantel. Ich zog die Schultern ein, schlug den Kragen hoch; auch dass ich die Hände in die Taschen schob, half wenig.
„Hocken wir uns doch eine Weile in die Kneipe Ecke Gormann“, schlug Hinze vor. „Dort kommt sie immer mal hin.“
„Könnte irgendwann sein.“
„Ach was“, meinte Hinze, „die taucht schon noch auf.“
Wir waren erst beim zweiten Bier und Korn, als eine vollbusige Frau, die trotz ihres schlohweißen Haars kaum älter als fünfzig wirkte, die Kneipe betrat und an einem Ecktisch Platz nahm, an dem schon ein vierschrötiger Mann saß, den sie offensichtlich kannte. Ihr Gesicht war gerötet – nicht so sehr vom Wetter, schien mir, als von der reichlich aufgetragenen Schminke. Ringe glitzerten an ihren Händen, und als sie ihren Mantel abgestreift hatte, den sie hinter sich auf die Bank gleiten ließ, sah man auch eine Brosche an ihrer Seidenbluse glitzern. Hinze versuchte, die Frau zu uns herüberzuwinken, doch sie sah ihn nur an. Der Mann guckte unwirsch und reckte die Schultern dabei.
„Wäre richtig nett, wenn Sie mal herkämen“, bat Hinze die Frau jetzt höflich. Mit einem kurzen Seitenblick holte er mein Einverständnis ein und wandte sich dann an den Wirt. „Eine Lage für drei!“
Die Frau ließ sich erweichen, sagte ein paar Worte zu dem Mann an ihrem Tisch und setzte sich dann zu uns – ihren Mantel ließ sie zurück. Sie musterte mich kurz.
„Auf Ihr Wohl!“, rief Hinze.
„Wäre das alles?“, fragte die Frau. „Oder was gibt’s noch?“
Sie wartete. Hinze aber wirkte plötzlich befangen. Nur an mich gerichtet, sagte er: „Das ist sie. Erklären Sie’s ihr doch selbst.“
Ich zögerte. Hemmungen waren in mir aufgekommen. Ich verschanzte mich hinter Andeutungen. Vor dreißig Jahren habe in ihrem Haus mal ein Kind gelebt, nach dem ich jetzt suche.
Damit konnte sie nichts anfangen. „Wie soll es denn geheißen haben?“, fragte sie.
Noch immer zögerte ich. Hinze fixierte mich noch misstrauischer als anfangs. Auf was hatte er sich da eingelassen? schien er zu fragen. Die Frau trank ihr Glas leer und stand auf.
„Was soll das?“, meinte Hinze zu mir. „Kommen Sie doch endlich zur Sache!“
„Finde ich auch“, sagte die Frau.
Ich überwand mich. Nicht um irgendein Kind ging es, sondern um eins, das Jizchak Filter hieß, bis es adoptiert wurde.
Die Frau setzte sich plötzlich. Es war, als könne sie stehend nicht ertragen, was sie da gehört hatte. Trotz ihrer Schminke war zu erkennen, dass sie blass wurde. Einen Augenblick lang schwieg sie, dann fragte sie: „Sind das etwa Sie?“ Ich nickte. Da breitete sie impulsiv die Arme aus und presste mich an sich. „Mein Jizchak!“, stieß sie hervor.
Der Geruch ihres Körpers, der sich mit dem Duft des süßlichen Parfüms vermischte, drängte sich vor jede andere Wahrnehmung meiner Sinne. Erst als ich mich von ihr befreit hatte und ihr in die Augen sah, durchfuhr es mich: Könnte das meine Mutter sein?
Als ob sie meine Gedanken erraten hätte, wehrte sie ab und hob die Hände dabei. „Rachelas kleiner Jizchak!“, beteuerte sie leise. „Nur Rachelas.“
Hatte mich ihr Ausruf „mein Jizchak!“ in Vermutungen gestürzt, so lösten jetzt der Name Rachela und das Wörtchen „nur“ andere Überlegungen in mir aus – die Frau musste meine Mutter gekannt und sie auch um das Kind beneidet haben. Warum sonst dieses so wehmütige „nur“? Aus den Adoptionsurkunden ging hervor, dass zur Zeit meiner Geburt Rachela Filter eine siebzehnjährige ledige Verkäuferin gewesen war – um etliche Jahre jünger also als die Frau da vor mir. War es nicht möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass Rachela Hilfe und Rat bei ihr gesucht hatte? Als ich der Frau das andeutete, wurde ihr Ausdruck weich, ja geradezu mütterlich.
„Wie wäre Rachela denn sonst zurechtgekommen mit ihren siebzehn Jährchen?“, sagte sie. „Ein Kind … ihre Arbeit bei Tietz, und sie ganz allein in Berlin. Ja, sie hat mich schon gebraucht!“
„Und ihr Mann, der Vater des Kindes, wo war denn der?“
„Männer“, entgegnete sie, wobei in der Betonung ein Leben voll Erfahrungen mitklang, „die Männer!“
„Könnte es sein, dass es mein wirklicher Vater war, der mich später adoptierte?“
„Wer auch immer“, entgegnete sie unwirsch, „ich hab ihm die Pest gewünscht, weil er uns den Jizchak genommen hat – dich weggenommen hat. Fast drei Jahre warst du bei uns. Und dann auf einmal nicht mehr. Das war nicht nur schlimm für Rachela. Auch für mich war’s schlimm.“
Sie schwieg so lange, dass ich sie schließlich bitten musste, weiterzusprechen.
„Brauchst nicht Sie zu mir zu sagen, ich heiße Else“, sagte sie. „Else Nowack. Du also bist der Jizchak!“
Es war, als könnte sie es noch immer nicht fassen.
„So heiße ich längst nicht mehr.“
„Ich weiß, ich weiß!“, rief die Frau. „Aber damals, als du noch bei mir unten in der Kellerwohnung auf der Fensterbank gesessen hast, riefen wir dich Jizchak.“
Kindheitserinnerungen – mein Gott, ganz vage und sehr verschwommen erinnerte ich mich wirklich an eine Fensterbank mit Geranien und an Füße, die draußen auf dem Bürgersteig an mir vorübergezogen waren. Ich nickte stumm.
„Und was ist aus meiner Mutter geworden?“, fragte ich dann.
„Sie war schön“, rief die Frau und wich damit meiner Frage aus. „Rachela war schön und gut gewachsen. Dunkle Augen, dunkles Haar. Ja, sie war schön!“
„Was ist aus ihr geworden?“, wiederholte ich.
„Oh“, sagte die Frau und blickte jetzt verstört von mir weg. „Wir haben sie retten können. Es ist ihr nichts geschehen.“
„Nichts geschehen“, hörte ich da plötzlich den Mann vom Ecktisch rufen. „Was erzählst du da, Else!“
Ich erschrak. Einen Augenblick lang erwog ich, den Mann zu befragen, ließ es aber und setzte mich stattdessen so, dass die Frau mich anblicken musste.
„Ich vertrage die Wahrheit“, versicherte ich ihr. „Also sag mir bitte, was aus meiner Mutter geworden ist!“
„Wir haben sie retten können“, beteuerte sie wieder.
Da hielt es den Mann am Ecktisch nicht länger. Er schob hastig seinen Stuhl zurück, kam mit schweren Schritten auf mich zu und reichte mir die Hand.
„Du bist der Jizchak“, sagte er, „aber ich bin der, der immer auf der Straße die Prügel gekriegt hat, weil ich nämlich aussah wie ein Jud.“
Das zwang mich, ihn genau zu betrachten – es war denkbar, dass er in der Nazizeit wegen seiner krausen Haare, der dunklen Augen und der gebogenen Nase zu leiden hatte. Sosehr ich mich auch bemühte, erinnern konnte ich mich nicht an ihn. Wie sollte ich auch – das alles lag ja Jahrzehnte zurück!
„Sie kannten mich?“
„Klar kannte ich dich!“
„Und meine Mutter auch?“
„Auch“, sagte er. „Und was die Else da erzählt, ist alles Mumpitz. Du wolltest doch die Wahrheit wissen – oder?“ Er wandte sich an die Frau. „Jüdischer Friedhof in der Großen Hamburger – so war’s doch, Else! Also, warum sagst du’s ihm nicht?“
Die Frau schüttelte den Kopf.
„Ist meine Mutter etwa dort begraben?“, fragte ich.
„Nein!“, schrie sie – es war zu spüren, dass sie litt.
„Von dort gingen doch die Transporte ab“, meldete sich Hinze, der die ganze Zeit geschwiegen hatte. Er blickte unsicher in die Runde. „Von dort hat man doch die Juden …“
„Das versteht er schon“, unterbrach ihn der Mann, der zu uns getreten war.
„Wie könnte ich es nicht verstehen“, erwiderte ich dumpf und dachte an meine Eltern, die von Duisburg den Weg nach Auschwitz gehen mussten – sie blieben meine Eltern, was auch immer ich jetzt über das Leben und Schicksal meiner wirklichen Mutter erfahren hatte.
„Woran denkst du?“, fragte mich leise die Frau.
Ich sagte es ihr.
„Mein Gott“, rief sie aus, „was waren das nur für Zeiten!“´ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters.
Erstmals in Jahre 2000 erschien im Wiesenburg Verlag Schweinfurth „Ich sah etwas, was du nicht siehst. Erinnerungen aus Ostdeutschland“ von Jutta Schlott: 16 Biografien verschiedenartigster Menschen aus der DDR: Eine Adlige, ein Lehrer, ein Auszubildender, eine Russin, ein Literaturwissenschaftler, eine finnische Regisseurin, ein Maschinenschlosser, ein Kulturminister, eine Heimerzieherin, ein Heimkind, eine Säuglingsschwester, ein Kantor … Hier der Anfang des Lebensberichts einer DDR-Bürgerin mit adeligem Hintergrund:
„DER BLICK VON DER SEITE
Carola
Du weißt doch eigentlich gar nichts über mich. Weißt du, dass ich aus dem Westen komme – und adlig bin? Na siehst du! Nicht, dass es mich zerreißt, aber ich muss in meiner Seele ungeheuer viel vereinen.
Meine Eltern sind aus dem Westen in den Osten gegangen. Mein Vater kam nach fünf Jahren in russischer Kriegsgefangenschaft in die damalige Bundesrepublik zurück. Der Bürgermeister im Ort war derselbe alte Nazi wie zur Hitlerzeit. Mach ich nicht noch mal mit, hat sich mein Vater gesagt. Er hat Kontakte in die DDR aufgenommen und ist ziemlich schnell rüber, allein, ohne Familie. Mein Vater hat seinen Weggang immer motiviert durch das Politische. Sicher, die Verhältnisse im Westen haben ihn angekotzt – aber vielleicht wurde nie die ganze Wahrheit gesagt. Ich weiß, dass mein Vater mit der Verwandtschaft nicht klar kam und dass er im Westen, wie alle in der Familie, als Forstarbeiter hätte schuften müssen, in den Wäldern um Hannover, die Gegend, wo sie damals wohnten.
Am Anfang hat er sogar illegal im Osten gelebt, in der Parteihochschule der NDPD in Buckow. Das Gebäude gleich rechts neben der Badeanstalt. Märkische Schweiz … st schön da!
Meine Mutter ist damals mehrfach von der Polizei aufgesucht worden, die wollten rauskriegen, wo ihr Mann steckt. Sie hat das Maul gehalten und auf alles geantwortet: Weiß ich nicht!
Bis 1950 war mein Vater illegal in Buckow, im Jahr drauf ist er zurück nach Hannover, hat sich meine Mutter geschnappt und sie sind zusammen in den Osten. Meine Mutter hochschwanger – und in dem Bauch, da war ich drin! Sodass ich überhaupt nischt anderes kenne als die DDR, da bin ick aufgewachsen mit allem, was dazugehört.
Aber bei uns zu Hause drehten sich die meisten Gespräche um das Leben auf dem Rittergut in Ostpreußen, von da stammte meine Mutter, da war sie das Mädchen aus dem Schloss. Ihre Onkel und Tanten, die ganze Verwandtschaft lebte ringsum auf anderen großen Gütern – och alle adlig.
Großgrundbesitzer wurden ja in der alten Bundesrepublik entschädigt, wenn sie als enteignet oder als Vertriebene galten. Meine Eltern kriegten mehr als einmal die Aufforderung, sie möchten sich 50.000 Mark von der Düsseldorfer Bank abholen. Sie haben das ignoriert. Sie wollten von denen kein Geld annehmen, das war unter ihrer Würde. Bei uns zu Hause lag immer dieser Wisch da, diese Aufforderung. So normal lag das Dings da, wie bei anderen Leuten ‘ne Neujahrskarte oder die Telefonrechnung. Das hat mich insofern geprägt, dass ich gelernt habe, dass man auf Geld scheißen kann.
Dabei hatten meine Eltern nischt, gar nischt! Die haben asketisch gelebt und uff allet verzichtet! Wir sind richtig arm groß geworden. Für die West-Verwandtschaft existierten wir nicht mehr – die hat uns höchstens böse Briefe geschrieben. Meine Eltern waren in ihren Augen Verräter und Kriminelle, weil sie in einen „kriminellen Staat“ übergesiedelt sind. Köstlich, nicht?
Manche meiner alten Verwandten leben noch, einige wollen keinen Kontakt zu mir, weil meine Eltern damals in die DDR rüber sind – obwohl’s mich ja noch gar nich gab! Der Bruch ist nie reparabel und das wird bis zu ihrem Tod so bleiben. Musst‘ ich auch erst lernen, dass es Dinge gibt, die sind absolut nicht reparabel.
Mein Bruder ist noch 89 abgehauen, vor der Grenzöffnung, und lebt jetzt in München. Ich will die wiederholte Zerstörung der Familie nicht mitbetreiben und fahr des Öfteren hin, zum Beispiel, wenn die Kinder konfirmiert werden. Ich reise also hin und lern’ die Verwandtschaft kennen. Die unterhalten sich nicht, die fragen mich nicht, die sagen nur: Du bist rot, Carola, du bist ’ne Kommunistin. Ich hätte das nie von mir behauptet, auch in der DDR nicht, das ist was – das muss man sich verdienen.
Nach dem guten Essen gehen wir in München durch den Stadtpark spazieren und meine Tante Marie Elisabeth von E. examiniert mich so lustig – halb Ulk und halb im Ernst. Sie kriegt mit: Ich kenne alle Pflanzen am Teich. Da war sie echt verblüfft. Im Westen fährt man mit dem Auto, hinterlässt seine Abgase und redet über Geld. Bei denen wird nur über Geld geredet! Und denn entwaffne ick sie und sage: Siehste, Tante Marie Elisabeth, ick bin nicht nur rot, ick bin och total grün! Denn finden se die Schublade nich mehr, wo se mir reinstecken können.
Es ist aber och sehr dummer Adel, aus dem ich stamme, muss ick leider sagen. Nicht alle, aber die Mehrheit meiner Verwandtschaft ist dummer deutscher Adel.
In gewissem Sinne bin ich konservativ. Konservativ, weil ich für die Bewahrung der Schöpfung bin. Ich würde nicht „Schöpfung“ sagen – aber für die Bewahrung dieser Erde. Auf dieser Ebene kann ich mich mit meinen konservativen Verwandten verstehen.
Ich war echte DDR-Bürgerin mit adliger Herkunft und in gewisser Weise auch mit dem Verhaltenskodex dieser Schicht. Die Tischsitten, wie man bei Tisch Gespräche führt, wie man sich in Gesellschaft benimmt – Knigge spielte eine wichtige Rolle in unserm Alltag. Ich hab gegen diese „Regeln“ tiefe Aversionen entwickelt. Ich hab früh gemerkt, wie falsch und verlogen diese „guten Sitten“ sind, es wurde nur formal betrieben.
Ich sollte stets auf der Sonnenseite gehen, gerade, mit erhobenem Kopf, hat mein Vater von mir gefordert. Aus Protest ging ich natürlich auf der Schattenseite und mit gesenktem Kopf! Er hat mich fast verprügelt deswegen.“
Erstmals 1990 erschien im Brandenburgischen Verlagshaus der Roman „Harte Jahre“ von Jürgen Ritschel: Nach dem Rauswurf aus dem Mitteldeutschen Verlag öffnete sich der Militärverlag der DDR einem Romanvorhaben, das sehr deutlich das Verhältnis von Schein und Sein dokumentiert, gewissermaßen als Modellfall DDR innerhalb der Nationalen Volksarmee. Letztlich endete dieses Vorhaben wiederum mit einem Verlagsrauswurf. Im gewandelten Militärverlag, dem Brandenburgischen Verlagshaus, erschien es 1990, wurde aber bald darauf im Zuge der Vernichtungsaktion von DDR-Literatur entsorgt. Und darum geht es in dem aufmüpfigen Buch:
Werner Rosenkranz meldet sich nach dem Abitur zur Armee als Soldat und wird Funktechniker einer Fliegerabwehr-Raketeneinheit. Er gerät sehr bald mit Methoden in Konflikt, die seine Ablehnung erfahren, denen er aber mit Schläue und Geschick entgegentritt. Sein Widersacher wird der Abteilungskommandeur, ein Artillerist, der die neuen technischen Herausforderungen nicht begreift und die er teils mit dümmlicher Befehlsgewalt zu übertünchen versucht. Junge Leute, klug und verantwortungsbewusst, aber durchaus keine Musterknaben, entwickeln eine gute Kameradschaft unter der Uniform des Soldaten, junge Leute, die von der Liebe zu ihren Mädchen geplagt oder beflügelt werden und die so manche Schikane deutlich beantworten. Dieser Roman ist von innerer Spannung durchwebt und gehört zu wenigen Titeln der DDR-Literatur, die sinnliche Erotik einfließen lassen. Hier der wenig erfreuliche Anfang – wenig erfreulich für die uniformierten jungen Männer:
- Kapitel
Da standen sie nun auf holprigem Pflaster irgendwo in Mecklenburg zwischen Feld und Wald, junge Männer, achtzehn, neunzehn Jahre alt. Einheitlich gekleidet. Ein Block in Grau. Abgesetzt auf einsamer Landstraße. Kaum auszumachen vor dem halbhohen Kiefernwald. Eine schneidende Stimme fuhr in die lockeren Reihen. Schlag der Stiefel, Straffen, Stille. Der Wind rauschte um die Wipfel. Jetzt deutlich zu hören. Motoren sprangen an. Leer fuhren zehn Lastkraftwagen in Marschrichtung an dem Trupp vorbei. Die jungen Soldatengesichter waren ernst. Zu ernst.
Werner Rosenkranz studierte die Züge des Majors, des Kommandeurs, den er seit zwei Tagen kannte. Sie waren von verbissener Emsigkeit gezeichnet, von Zorn zuweilen. Immer standen Verantwortung und Gewichtigkeit im Blick. Stets trug er eine Unmutsfalte in dem winzigen Kinn unter markanter Nase. Ein sehr dynamischer Mann, dieser Major Ritter. Kopf und Körper zeigten in ihren Bewegungen an, dass er immer zugleich an jedem Ort sein wollte, dass er alles sah, alles entdeckte, auch die geringste Verzögerung, den kleinsten unpassendsten Laut, Und dann schlug seine Stimme zu, fuhr in die Seelen, erschütterte. Junge, weichherzige Männer darunter. Rosenkranz. Eben erst das Abitur abgelegt. Eben den ersten Schritt ins Leben getan, in ein Leben, das man ihm völlig anders vermittelt hatte. Und eben war eine Mauer gezogen worden, die man Schutzwall nannte. Ein Vorgang, den er entfernt kommentierte wie ein Naturereignis: Es war nun mal so. Und es war eben so, dass er über Nacht zu einer Entscheidung finden musste: entweder zwei Jahre Armee oder kein Studium. Da keimte so etwas wie Einsicht in Unabänderliches. Aber jetzt, da er merkte, wie wenig wert er war, weil man ihn anzubrüllen und zu erniedrigen sich erlaubte, wich dieser Keimling Einsicht der Frage: Warum bin ich hier?
Major Ritter war ein adretter Mann. Das Haar trug er übermäßig kurz geschoren. Es begann eine Koppelbreite über den Ohrenspitzen. Die Mütze mit straff geschwungenem Spiegel saß millimetergenau nach Vorschrift. Die Stiefelhosen waren exakt ausgebügelt und standen wie Segel von den Beinen. Die Stiefel glänzten, als wären sie aus schwarzem Glas. Die Ausstrahlung des Mannes, die Haltung, jeder Satz, den er sprach, jede Bewegung zeugten von unantastbarer Autorität und von einer Distanz, die Rosenkranz frieren ließ.
Auch jetzt war der Major mit geschärftem Spürsinn um den kleinen Trupp herum unterwegs, als segelte er im straffen Frühjahrswind von hinten nach vorn und von vorn nach hinten. Er war an jeder Stelle zugleich. Er saß ihnen im Nacken oder auf der Stirn. Eine teuflische Weise, Sie engte Rosenkranz ein. Sie provozierte seinen Trotz. Er war bei seiner Mutter in höchstem Freiraum aufgewachsen. Freilich, ein bisschen verwöhnt. Einzige echte Erinnerung an ihren Mann. Bei Stalingrad vermisst. Geblieben war auch der winzige Laden. Kurzwaren aller Art. Eben ein Geschäft, keine lebendige Erinnerung. Zog Werner Rosenkranz die zum Verwöhnen neigende Mutterliebe ab, erinnerte er sich durchaus an Strenge. Aber nie verletzte diese Strenge sein Persönlichkeitsgefühl.
Die militärische Einheit, die seit einem Tag bestand, duckte sich von der ersten Minute an unter dem Druck ihres Kommandeurs. Rosenkranz spürte schon jetzt, wie solche Saat in einigen jungen, noch unerfahrenen Offizieren zu keimen begann. Sie untersetzten den Unmut des Alten, vervielfachten ihn, engten ein, indem sie Echo waren, Strafen androhten, schnauzten, Rosenkranz fühlte sich als Gefangener. Er marschierte ernst, der junge Soldat. Zu ernst. Aber er war jung genug, die Gedanken kippen zu können. Die Uniform nahm ihm das heitere Leben nicht, dem Täuscher und Senkler, der mit Messingabsätzen übers Pflaster geknallt war, zu Hause. Der in engsten Röhrenhosen lief. Der mit seinen Freunden zu bestimmten Zeiten durch die Kleinstadt spazierte, um zu sehen und gesehen zu werden. Sie nannten es senkeln, und wer senkelte, war ein Senkler. Und wer dabei täuschte, den Weltmann markierte mit erstem Flaum unter der Nase, wer ein Mädchen umwarb und so tat, als könnte er tausend auf einen Wink haben, war ein Täuscher. Täuscher und Senkler musste sein, wer anerkannt sein wollte. Jeans gehörten dazu, die offiziell verpönten. Kenntnisse der Rock-’n‘-Roll-Musik, der verbotenen Namen der Sänger, Titel. Bill Haley: Rock around the clock. Elvis: …everybody let’s rock. Es genügte, einige Zeilen vorzusingen oder zu schwärmen von Johnny Holiday, von Little Richard. Ein Täuscher durfte verliebt sein, sogar untröstbar unglücklich, zeigen aber musste er erhabenen Stolz. Einen Täuscher warf doch kein kleines Mädchen aus der Bahn! Gedanken verriet man nicht, auch nicht jetzt, da ein Täuscher nach Zewentin marschierte.
Siehst du mich, Anita? Siehst du mich marschieren? In Stiefeln. Lässig. Ungeheuer kraftvoll, als wäre der Marschblock ich. Ganz allein ich. Ich sehe dich, mein Gedankenengel. Du schwebst über uns wie ein Federchen im Aufwind. Neben mir laufen Schmidtel und Flater, vor uns Lola und Karli Kippe, weiter hinten Frettchen und Käuzchen. Meine Freunde. Tolle Kumpel. Hätten echte Täuscher sein können, wären sie in unserer Stadt aufgewachsen. Sie kennen dich von meinem Erzählen. Lass sie ruhig lästern, wenn ich schwärme. Sie haben nie deine tiefen, aufwühlenden Blicke erlebt, die stumme Sehnsucht darin, nie dein Leid erfahren, das übles Geschwätz verursacht hat. Sie kennen deine dunklen Augen nicht, nicht dein schwarzes aufgestecktes Haar, deinen weichen Mund. Sie brauchen nicht zu wissen, dass ich dich nie geküsst habe. Es gab wenige Spaziergänge und nur einen, bei dem wir Hand in Hand liefen. Unsere Liebe war Sehnen, Träumen, Schwärmen.
„Triefen Sie nicht, Genosse Rosenkranz!“
Er war außer Tritt geraten, war weggetreten in die letzte Phase seiner Pennälerzeit. Peinlich. Der Major, angelockt von dieser Ermahnung, behielt ihn im Blick. Aber Gedanken sind wie stille Musik. Sie untermalen den äußeren Ablauf. Rosenkranz war bald in seinem Heimatort, bei der Abschiedsfeier mit seinen Freunden, bei Anita, bei dem Schmerz um seine kleine enge Welt, der so richtig aufgebrochen war im Rausch.“
Erstmals 2009 erschien Projekte-Verlag Cornelius Halle als Band 2 seiner Raumlotsen-Tetralogie „Orbitale Balance“ von Carlos Rasch: Im Verlaufe des abenteuerlichen Geschehens in Band zwei bekommt es der Jungastronaut Jan mit einem geheimnisvollen Mann namens Puppmann zu tun. Verwilderte Roboter, die ihn für ein Gerät halten, das zu reparieren ist, machen ihm in „Hotel für Fabrikate“ zu schaffen. Ferner setzen ihm Raumpiraten zu. Auch Astronauten machen Urlaub, natürlich auf Erden. Doch selbst dort bleiben sie nicht von Abenteuern verschont. Als Cora sich auf einer Meeresfarm in der Karibik bräunt, muss sie aus heiterem Himmel eine Invasion von Kraken abwehren.
In „Aktion Meteoritenstopp“ ist der Raketenfriedhof Umfeld für die beiden Handlungsorte Raumfahrtmuseum und dem Raumschiff der Piraten „Stern von Magreb“ als Plätze der Versöhnung eines uralten über 2000 Jahre anhaltenden Völkerstreites. Das geschieht während eines unplanmäßigen Meteorfalls, bei dem zum Erstaunen der Menschheit der legendäre und hochverehrte Altraumfahrer Ben die Fronten wechselt, um Raumpiraten beizustehen, die Gold aus Mondbergwerken zur Erde schmuggeln. Was steckt hinter dieser Fahnenflucht gerade bei Bens letztem Einsatz im Auftrag der Raumflotte vor Ausmusterung ins Rentenalter? Ein kleiner Auszug gefällig? Hier ist er:
„Dialog mit einer Horde von Robbis
„Beim Drall der Milchstraße“, polterte Jan erbost dazwischen und unterbrach damit das Empfangszeremoniell. „Was für Leute seid ihr eigentlich? Wie, beim Hagel der Perseiden, seid ihr hier auf diesen PROTZ gelangt? Wo befindet ihr euch?“
„Wir stehen Ihnen unmittelbar gegenüber“, erhielt er Antwort. „Können Sie uns denn nicht optiken? Dann muss aber ziemlich viel von Ihnen kaputt sein. Es war sicherlich höchste Zeit, dass Sie unser Hotel für Fabrikate aufsuchten.“
„Donner und Doria! Ich weiß nicht, ob bei mir eine Schraube locker ist oder bei euch“, ließ sich Jan wieder vernehmen. Es war ihm anzumerken, wie sehr ihn dieser merkwürdige Dialog ärgerte, aber auch zugleich verwirrte.
„Aha! Das war der erste Reparaturhinweis“, flüsterte einer der Roboter mit halber Sendestärke. „Eine Schraube ist bei der Zellule locker. Wir müssten jetzt nur herausfinden, welche das ist.“
„Nennt mir mal die Entfernung von mir zu euch beziehungsweise von euch zu mir“, verlangte Jan argwöhnisch.
Eilfertig sprang ein Roboter vor, maß die Strecke aus und sagte: „Von uns zu Ihnen sind es fünf Meter, elf Zentimeter und drei Millimeter. Wir befinden uns also fast auf Kontaktabstand. Würden Sie es registrieren können, wenn ich sie mal vorsichtig antippe?“
Jan wurde wütend. „Bei der Unantastbarkeit des Lebens: Hören Sie auf, Sie Ulknudel, nur verrücktes Zeug zu reden!“, brüllte er los. „Treiben Sie keinen Spaß mit mir. Wer Sie auch sein mögen, können Sie denn nicht sehen, wenn Sie draußen vor meinem Gleiter stehen, dass ich eine harte Landung gemacht habe und der Ausstieg verkeilt ist? Holen Sie mich hier schleunigst raus! Ich bin verletzt, brauche Hilfe! Mir läuft schon Blut in den Atemschlauch!“
„Was sollen wir herausholen, bitte?“, fragte der Roboter Rea Lais ratlos. „Ist die Schleuse so etwas wie ein Fach an Ihrer Seite? Aber wo? Wir haben es noch nicht entdecken können.“
„Was für eine merkwürdige Aussprache diese Leute haben“, murmelte Jan und schluckte etwas Blut hinunter. Er wünschte, das Schott vor ihm wäre durchsichtig, damit er erkennen konnte, was da draußen war. „Ob es Überlebende einer Expedition sind, schon lange verschollen, die sich hier auf dem PROTZ gerettet haben und auf ihm durchs All reiten, inzwischen halb irrsinnig? Wie konnten sie sich ernähren? Richtig kindisch, dieses Geplapper. Oder sollten sie etwa …? – Hallo! Ihr dort draußen. Wie seht ihr aus? Schildert euch mal.“ Jan schien seine Begriffsstutzigkeit zu überwinden.
„Wir sollen uns beschreiben? Alle zusammen oder einzeln? Einzeln wäre zuviel verlangt. Es würde lange dauern, denn wir sind hier über hundert Figuren mit zahllosen technischen Parametern.“
„Der Himmel bewahre mich vor so einer langen Prozedur. Nein, nein. Ich brauche nur die Beschreibung desjenigen, der mir am nächsten steht“, verlangte Jan.
„Das bist du, Rea Lais. Sage der Zellule, wie du beschaffen bist.“
„Nun, ich bin der Hotelsender. Meine Klassifikation: Spezialisiertes Fabrikat! Kürzlich umgebaut und modernisiert. Dabei Hauptspeicher stoßfrei gelagert. Äußerlich eckig. Innerlich anstelle von Drahtleitungen eine Menge integrierte Hybridschaltungen.“
„Aha, also überaus primitiv und noch keine Mikrowellenvektoren, vermutlich auch nur glasfaseroptische Signalkabel. Also völlig ohne Superchips. Interessant, interessant. Danke, das genügt“, sagte Jan und seufzte. Die Platzwunde auf der Stirn war inzwischen offenbar verkrustetet, denn es sickerte kein weiteres Blut mehr über sein Gesicht in den Helmschlauch. Daher war er auch ruhiger geworden. „Dämmert es mir doch endlich, dass ich es mit Robbis zu tun habe. Diese dämlichen Fragen, die ihr mir gestellt habt, samt dem albernen Gehabe können nur von bitschwachen Blechkerlen kommen. Na schön, ihr eisernen Hirnis. Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich mit euch umzuspringen habe. Also los! Schaltet eure Arbeitsspeicher ein, ihr superklugen Idioten! Kennt ihr überhaupt noch die Robotergesetze? Bei allen Archiven der Raumflotte, wie mögt ihr hier auf diesen PROTZ geraten sein?“
„Was meint die Zellule mit Robotergesetz?“, fragte eine scheppernde Stimme. „Sicherlich ist damit unsere Hotel- und Hausordnung gemeint“, schlussfolgerte sie.
„Da bin ich sprachlos“, schimpfte Jan. „Das müssen geradezu vorweltliche Eisenmänner sein, die noch nicht einmal wissen, wie die Robotergesetze lauten. Welcher irdische Trottel hat euch auf diesem PROTZ ausgesetzt? Ihr müsst eine katastrophale Fehlentwicklung sein. Daher wurdet ihr ins All geschossen. Ausgerechnet ich muss euch in die Arme laufen. Ihr seid nur ein Schrotthaufen.“
„Reden Sie nicht so viel. Sie sind defekt“, schaltete sich eine neue, bisher noch nicht vernommene Stimme mit resoluter Sendeleistung ein. Das deutete auf einen Führungsroboter hin, der erst jetzt hinzugekommen sein mochte.
„Wir sollten die Zellule umgehend reparieren, Com Pu, ehe wir uns weiter mit ihr unterhalten“, schlug Rea Lais vor.
„Richtig. Schweißt sie auf!“, befahl der Führungsroboter Com Pu.
„Halt! Wartet!“, rief Jan hastig. „Ihr verdammten Roboter gehorcht mir einfach nicht und seid imstande, mich mit starker Energie lebendigen Leibes in der Schleuse zu rösten“, erkannte er die ihm nun drohende Gefahr. „Neuerdings habe ich es wohl nur noch mit verrotteten, verwilderten Robotern zu tun, die bestrebt sind, mich in die schlimmsten Schwierigkeiten zu bringen.“ Jan dachte dabei an den Prüfungsflug für seinen Pilotenschein als Raumlotse, als er in einem Hochtal der Pyrenäen nach einer Notlandung mit einer alten Lastrakete auf vergessene Schürfroboter eines stillgelegten Bergwerkes traf, und auch an das Geschehen, als vor zehn Tagen die Raumstation NORDLICHT ins Taumeln geraten war.
Erstmals 1980 veröffentlichte Renate Krüger im Kinderbuchverlag Berlin „Geisterstunde in Sanssouci. Bilder aus dem Leben Adolph Menzels“: Das riesige Bild, das Menzel malen soll, wird fast anderthalb Meter hoch und über zwei Meter lang werden. Es steht auf Menzels stabilster Staffelei, und er turnt auf Stühlen und einer Trittleiter davor herum wie ein Affe. Menzel weiß selbst, dass das unheimlich aussieht, deshalb darf ihn auch niemand dabei beobachten, nicht einmal seine jüngere Schwester Emilie, damit sie vor dem zwergischen Bruder nicht allen Respekt verliert. Anstrengend ist dieses Herumturnen, in der Linken die Palette auf dem Daumen, das Malbrett mit den angemischten Farben, in den Fingern ein halbes Dutzend Pinsel; in der Rechten den Pinsel, mit dem er gerade malt, und dann rauf, ganz unter die Decke, wo das Licht verflimmert und verglimmt und gerade noch die goldenen Ornamente sichtbar sind, dann wieder runter, vorsichtig mit dem Fuß tastend, zurücktreten und die Malerei aus einiger Entfernung prüfen. Ob das Licht auf dem Bild nun auch wirklich ganz lebendig ist? Man muss es mit den Händen greifen können.
Die Autorin erzählt von dem kleinen und doch so großen Maler Menzel im Berlin des 19. Jahrhunderts. Einige seiner berühmten Gemälde sind hier zu Geschichten geworden: erbaulich, prächtig, vergnüglich, nachdenklich und allesamt unterhaltsam. Ein merkwürdiges Balkonzimmer wird gezeigt – durch die geöffnete Tür will eine neue Zeit herein. Es ist von einem König die Rede, der am liebsten Flöte spielt, wenn er nicht gerade auf dem Schlachtfeld ist. Es herrscht Gewitterstimmung, und es werden vornehme Damen gemalt und Soldaten und Kammerherrenzöpfe, Eisengießer und Lokomotiven und Licht und Musik . Gleich zu Beginn des Buches stellt sich der Künstler selbst vor – in einem Gespräch mit einem gewissen Hummel:
„Ein Selbstbildnis: 1834
Also, Herr Erdmann Hummel, an mir soll es nicht liegen, ich führe jetzt Ihren Auftrag aus. Ich habe alle angefangenen Arbeiten weggeräumt, sitze an meinem Zeichentisch und zeichne mein eigenes Bild, ganz wie Sie es wünschen.
Ich bin es gewohnt, dass ich jedes bestellte Bild zeichne, ich muss ja schließlich meine Familie ernähren. Ja, lachen Sie nicht, Herr Hummel, Sie wissen schon, wie ich es meine. Ich bin zwar erst neunzehn Jahre alt, und in diesem Alter hat man eigentlich noch keine eigene Familie. Und doch! Seit Vater vor zwei Jahren gestorben ist — er hieß übrigens auch Erdmann, genau wie Sie, Carl Erdmann Menzel —, muss ich allein für Mutter und Geschwister, die elfjährige Emilie und den achtjährigen Richard, sorgen. Und ich kann es. Ich habe es geschafft, meines Vaters Werkstatt weiterzuführen und sogar noch zu vergrößern. Und nun kommen Sie, Herr Hummel, einer der berühmtesten Maler Berlins, und geben mir einen Auftrag, der mir zwar kein Geld einbringen wird, dafür aber Ehre und Ruhm.
Sie wollen mein Selbstbildnis für den Berliner Künstlerverein. Und ich, so meinen Sie, soll Mitglied dieses Vereins werden, obgleich ich noch jung bin und die Kunstakademie nicht bis zum Ende besucht habe. Quatsch Kunstakademie, haben Sie gesagt, deine Kunstakademie ist die Natur, Menzel, halte du dich nur an die Natur. Du sollst einer von uns werden, und als Eintrittsgeld brauchen wir dein Selbstbildnis, und nun ran an die Arbeit, zeig mal, wie du aussiehst und wie du dich selbst siehst …
Na schön, Herr Erdmann Hummel!
Ich bin noch immer der Menzelzwerg, und daran wird sich wohl nichts mehr ändern, ich wachse nicht mehr. Meine Schwester Emilie ist fast so groß wie ich. Als sie am vorigen Sonntag zu einem Besucher sagte: „Warten Sie, ich werde meinen kleinen Bruder holen“, da habe ich ihr eins hinter die Ohren gegeben, auch wenn es mir mehr wehtat als ihr. Aber schließlich bin ich das Oberhaupt der Familie … Auch wenn ich noch immer nicht vom Stuhl aus mit den Beinen auf den Fußboden komme und sie baumeln lassen muss wie mein kleiner Bruder Richard.
Mitglied des Berliner Künstlervereins! Bei diesem Gedanken aber fühle ich mich gleich viel größer. Und dafür will ich gern mein eigenes Bild als Eintrittspreis hergeben. Ich bin auch ziemlich neugierig, wie ich eigentlich aussehe, denn bis jetzt habe ich noch keine Zeit gehabt, mich selbst zu zeichnen. Ich hatte immer mehr als genug zu tun mit Abbildungen von Pferden und Kanonen, Pflanzen und Tieren, Handwerkern und ihren Hausbauten, Bauern auf dem Feld und im Stall.
Eigenartig ist es, wenn man sich so gegenübersitzt, sich selbst aufs Papier bringen will. Es scheint so, als blicke mir aus dem Spiegel ein fremder Mensch entgegen, mit dem ich mich unterhalten muss, damit ich ihn besser kennenlernen kann.
Woher bist du gekommen, kleiner Menzel? Na, das weiß doch fast jeder! Aus Breslau sind wir hierher nach Berlin gezogen. Vater war in Breslau Lehrer, er hatte eine eigene private Schule mit lauter Mädchen, das war ein Geschnatter im Haus! Die Mädchen mochten ihn sehr, und wer wollte, konnte eine Menge bei ihm lernen. Aber er war nicht gern Lehrer, er wollte lieber zeichnen, die Natur beobachten, Bücher illustrieren, eben das, was ich jetzt tun darf. So gab er die Schule auf und bemühte sich um Aufträge zum Zeichnen. Aber Breslau ist zu klein. Schließlich verkaufte er unser Haus, und wir zogen nach Berlin. Es war ein schönes Haus, das wir da verließen. „Zur Goldenen Muschel“ hieß es, weil über der Haustür eine Muschel aus Stein angebracht war.
Gold habe ich an ihr freilich nicht gesehen, das war schon längst abgeblättert. Unser Haus hier in der Berliner Wilhelmstraße hat keinen Namen, nur die Nummer 39, und unsere Wohnung ist auch längst nicht so groß wie die in der „Goldenen Muschel“.
Wie groß soll mein Bild eigentlich werden? Davon hat Herr Hummel nichts gesagt. Es darf nicht angeberisch werden, aber auch nicht zu klein. Dieses Blatt hier, denke ich, so groß wie eine Heftseite, wird wohl genügen. Und in welcher Technik? Ich werde es mit dem Bleistift probieren, damit arbeite ich am liebsten. Er muss ganz kurz sein. Es kommt mir dann immer so vor, als zeichne ich mit den Fingern. So wie jetzt. Ich habe nur noch einen Stummel in der Hand. Aber es geht leicht und schnell damit.
Allzu lange darf ich mich mit meinem eigenen Bild auch nicht aufhalten, denn es wartet noch andere Arbeit auf mich, und ich will meine Auftraggeber nicht enttäuschen.
Ich weiß noch genau, wie es war, als damals nach Vaters Tod der Inhaber einer Buchdruckerei persönlich zu uns kam, um alle Aufträge, die er uns erteilt hatte, zurückzuholen. Vater sei doch nun leider tot, und er als Druckereibesitzer und Geschäftsmann müsse sich wohl nach einem anderen Zeichner umsehen, aus unserer Werkstatt könne er ja nun nichts mehr erwarten.
„Weshalb nicht?“, fragte ich. „Ich bin ja schließlich auch noch da!“
„Du?“, fragte er von oben herab und maß mich von Kopf bis Fuß, und dabei hatte er wirklich nicht viel zu messen. Doch dann wurde er verlegen und fragte schnell noch einmal: „Sie?“
Ja, ich … Ich war damals siebzehn Jahre alt, und es gab fast nichts mehr, was ich noch nicht gezeichnet, woran ich meine Augen und Finger noch nicht geübt hatte.
„Sie sollen pünktlich beliefert werden, verlassen Sie sich auf mich!“, sagte ich und hielt Wort.
Ich weiß auch noch genau, wie es war, als er die fertigen Zeichnungen abholte. Ja, er kam selbst, er war wohl gespannt. Allerdings wollte er mir weniger Geld zahlen als meinem Vater, aber darauf ließ ich mich nicht ein.
„Haben Sie etwas an meinen Zeichnungen auszusetzen?“
„Nein. Aber Sie haben keine Kunstakademie besucht …“
Für den Maler Hummel spielt das keine Rolle. Es wäre ja wirklich besser gewesen, wenn ich Zeit für die Kunstakademie gehabt hätte, aber ich hatte sie eben nicht. Schließlich bezahlte der Druckereibesitzer doch den vereinbarten Preis. Mein erstes selbst verdientes Geld …
Eigentlich kann ich jetzt den Kopf ganz schön hoch tragen und mich auch so zeichnen. Ich brauche mich nicht zu verstecken oder zu ducken.
Kopf hoch, Adolph Menzel! So sagte ich damals immer wieder zu mir selbst, wenn es schwer wurde. Jetzt kommt es auf dich an, auf deinen Fleiß, auf deine Ausdauer, auf deine Fantasie! Entweder du überwindest die Schwierigkeiten, oder du wirst von ihnen zu Boden gedrückt!
Friss, Vogel, oder stirb!
Dieses Wort habe ich von einem Handwerksburschen gehört. Er saß an der Spree und aß knochentrockenes verschimmeltes Brot. Natürlich schmeckte es ihm nicht, aber besser dies als verhungern!
Friss, Vogel, oder stirb!“
Es lohnt sich auf jeden Fall, sich einmal die Zeit zu nehmen und sich in aller Ruhe die Bilder dieses berühmten Malers Adolph Friedrich Erdmann Menzel, ab 1898 von Menzel, anzuschauen und auf sich wirken zu lassen
1895 hatte Kaiser Wilhelm II. Menzel 1895 den Titel Wirklicher Geheimer Rat mit dem Prädikat Exzellenz und 1898 den Schwarzen Adlerorden verliehen, der mit dem persönlichen Adel verbunden war. Der Künstler stand diesen Ehrungen allerdings zunehmend skeptisch gegenüber und sprach von seinen Orden gern als all „dem ganzen Kladderadatsch“.
1850 war Menzel übrigens in den literarischen Verein „Tunnel über der Spree“ aufgenommen worden, zu dem auch Theodor Fontane, Paul Heyse, Franz Theodor Kugler und Theodor Storm sowie ein gewisser Heinrich Seidel gehörten. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte. Dazu demnächst vielleicht mehr. Die Vereinsmitglieder trugen dort Tarnnamen. Menzels Vereinsname lautete – „Rubens“.
Und hier zum guten Schluss noch eine Würdigung des berühmten Malers von einem ebenso berühmten Schriftstellerkollegen – Fontane über Menzel: „Menzel ist sehr vieles, um nicht zu sagen alles“, sagt der Dichter über den Maler. Er spricht damit die Themenvielfalt des Künstlers an, seinen malerischen Angriff auf alles Sichtbare. Tatsächlich zeichnet und malt Menzel sein ganzes Leben lang – Portraits, Landschaften, Interieurs, Historienbilder, Großstadtszenen, den berühmten Friedrich II. – Zyklus. Mit dem „Eisenwalzwerk“ schafft er das erste große Gemälde einer industriellen Produktionsstätte, auf dem nicht Maschinen dominieren, sondern die Arbeiter. Was immer der Künstler als Motiv wählt – es überrascht stets sein besonderer, für seine Zeit ungewöhnlicher Blickwinkel. Menzels eigene Erfahrung fließt in seine Bilder ein, verleiht ihnen eine menschliche, mitfühlende Dimension. Menzel war ein einzigartiger Zeichner und Maler, ein herausragender Chronist seiner Zeit, der mit scharfem, aber nie entblößendem Blick sein soziales, geistiges und politisches Umfeld wiedergibt. Seine Aufmerksamkeit richtete sich immer auf den Menschen – egal ob er sich Friedrich den Großen, König Wilhelm I. oder Arbeiter im Eisenwalzwerk als Motiv vornahm. Und das Buch „Geisterstunde in Sanssouci“ von Renate Krüger macht Lust auf mehr – mehr Menzel.
Viel Vergnügen beim Lesen und hintergündigerem Schauen, weiter einen schönen Sommer-Mai und bleiben auch Sie weiter vor allem schön gesund und munter und bis demnächst.
EDITION digital war vor 27 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.100 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()