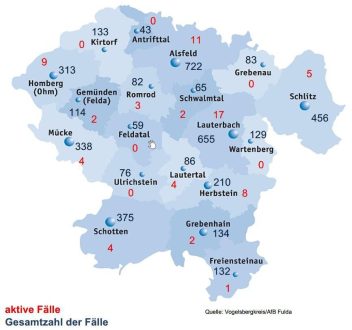Raus aus der Klinik und rein ins Leben – Wohnstättenwerke für Menschen mit Behinderung
„Eine sehr große Anzahl psychisch Kranker und Behinderter [leben] in den stationären Einrichtungen unter elenden, zum Teil als menschenunwürdig zu bezeichnenden Umständen, ” stellte 1973 eine von der Bundesregierung einberufene Sachverständigenkommission zur Lage der Psychiatrie in Deutschland fest.
Bis Anfang der 1970er Jahre lebten viele Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen oft jahrelang in psychiatrischen Großkrankenhäusern – ein Drittel von ihnen sogar länger als zehn Jahre. Durch die abgelegene Lage der Kliniken waren sie meist isoliert von der Außenwelt und Strukturen zur Wiedereingliederung gab es nicht. Stattdessen gab es Schlafsäle mit bis zu elf Betten, zu wenig qualifiziertes Personal und unzumutbare hygienische Verhältnisse – so das Ergebnis der Sachverständigen. In der sogenannten Psychiatrie-Enquête von 1975 forderten sie daher nicht nur „Sofortmaßnahmen zur Befriedigung humaner Grundbedürfnisse“, sondern empfohlen auch, gemeindenahe Versorgungsstrukturen aufzubauen. Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen sollten so in ihrem Lebensumfeld behandelt und in die Gesellschaft integriert werden.
Wohnstättenwerke als gemeindenahes Konzept
Hilda Heinemann, Ehefrau des damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann, gründete bereits Anfang der 70er Jahre ihre eigene Stiftung, um vor allem Menschen mit Behinderungen die Eingliederung in die Gesellschaft und die Arbeitswelt zu ermöglichen. Im Jahr 1971 gab es der Stiftung zufolge in Deutschland etwa 300 000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung. Damals endete die systematische Betreuung in der Regel zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr. Danach waren viele Eltern nicht mehr in der Lage, ihre Kinder in den Kreis der Familie zurückzunehmen. Und wenn doch, dann wurde es spätestens dann problematisch, wenn die Eltern selbst pflegebedürftig wurden oder starben. Vielen blieb dann oft nur noch der Umzug in eines dieser psychiatrischen Krankenhäuser.
Hilda Heinemann hatte sich mit ihrer Stiftung das Ziel gesetzt, sogenannte Wohnstättenwerke zu bauen, um Menschen mit Behinderung ein neues Zuhause außerhalb der Familie oder einer psychiatrischen Klinik zu schaffen. Sie sollten dadurch besser versorgt werden und die Möglichkeit haben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Deshalb plante ihre Stiftung ebenfalls in Zusammenarbeit mit Industrie und Wirtschaft, um Arbeitsplätze für die Bewohner*innen der Wohnstättenwerke zu schaffen.
Vom Gästehaus zum Wohnstättenwerk – das Unionhilfswerk wird zum Vorreiter
Das Unionhilfswerk zählte zu den Pionieren auf dem Gebiet neuer Versorgungsstrukturen von Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderung. Schon vor der Veröffentlichung der Psychiatrie-Enquête baute es sein Jugendgästehaus „Geschwister-Scholl-Heim” in der Rheinbabenallee mit Unterstützung der Hilda-Heinemann-Stiftung zu einem Wohnstättenwerk für Menschen mit Behinderung um. Die 1972 eröffnete Einrichtung stellte bundesweit ein Modell dar und erfuhr große Resonanz.
Die 32 Plätze waren schnell belegt – überwiegend durch ehemalige Patient*innen der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik. Ermutigt durch diesen Erfolg funktionierte das Unionhilfswerk sein zweites Jugendgästehaus, das „Max-Habermann-Haus” in der Podbielskiallee, zu einem Wohnstättenwerk für Menschen mit psychischen Erkrankungen um. Mit beiden Häusern schloss das Unionhilfswerk eine große Lücke in der Versorgung von Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen. Ziel der Wohnstättenwerke war es, die Unabhängigkeit von fremder Hilfe und die Eingliederung in das Berufsleben zu fördern sowie eine ambulante Betreuung vorzubereiten.
„Unser Haus dient dem Zweck, die Bewohner an das tägliche Leben heranzuführen, denn sie kommen ja aus Familien, in denen sie wenig Gelegenheit hatten, mit den Erfordernissen des Alltags konfrontiert zu werden. Aber die Bewohner, die aus den Pflegeanstalten kommen, sind es nicht gewohnt, mit den täglichen Dingen des Lebens fertig zu werden. Und hier in unserem Hause werden sie an die Probleme herangeführt, beispielsweise, daß sie erstmals schon allein zu ihren Arbeitsstätten fahren, dann über ihre Freizeit selbst verfügen und entscheiden können, wie sie sie dann ausgestalten.“ Joachim Fahl, Leiter der Wohnstättenwerke des Unionhilfswerks, in der Berliner Rundschau 1972
Im nächsten Artikel erfahren, wie sich die Angebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen weiterentwickelten und wie eigentlich die USE zum Unionhilfswerk kam.
Quellen:
Deutscher Bundestag, Drucksachen 7/4200 und 7/1124
Wikipedia/Psychiatrie-Enquete
Deutsches Ärzteblatt 98/2001
40 Jahre Psychiatrie-Enquete. Wo stehen wir, wie geht es weiter?, Dokumentation zur Fachtagung am 4. Dezember 2015
Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V.
Berliner Morgenpost, 22.5.1971
Der Tagesspiegel, 22.5.1971
Berliner Rundschau, 25.05.1972
Tagesspiegel, 2.11.2021
Unionhilfswerk
Schwiebusser Straße 18
10965 Berlin
Telefon: +49 (30) 42265-6
Telefax: +49 (30) 42265-707
http://www.unionhilfswerk.de/
Telefon: 030/422 65 813
E-Mail: unternehmenskommunikation@unionhilfswerk.de
![]()