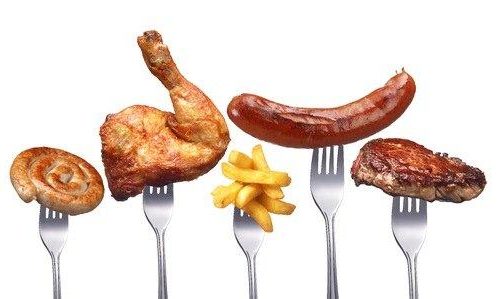WIdOmonitor: Kinder von Alleinerziehenden und Müttern mit niedrigem Einkommen stärker durch die Pandemie belastet
Bei den Antworten auf die Fragen zur seelischen Gesundheit der Heranwachsenden zeigt sich ein deutliches soziales Gefälle: Während der Corona-Pandemie haben vor allem Alleinerziehende und Mütter mit einfacher Bildung und geringem Haushaltseinkommen eine Verschlechterung der seelischen Gesundheit ihrer Kinder bemerkt. Das sagen deutlich mehr Geringverdienerinnen (51,0 Prozent) und Alleinerziehende (44,1 Prozent) als der Durchschnitt mit 34,9 Prozent. Generell wird die aktuelle seelische Gesundheit des eigenen Kindes im Vergleich zur körperlichen Gesundheit deutlich schlechter bewertet. 59,4 Prozent schätzen den seelischen Zustand ihrer Kinder als gut oder sehr gut ein. Auch hier fällt die Bewertung der Mütter mit einfacher Bildung (50,2 Prozent) oder geringem Haushaltseinkommen (40,7 Prozent) sowie von Alleinerziehenden (45,9 Prozent) deutlich schlechter aus.
„Wie ein roter Faden zieht sich durch fast alle Ergebnisse unserer Untersuchung, dass Kinder aus sozial schwächeren Familien deutlich stärker durch die Pandemie belastet waren“, sagt Klaus Zok, Studienleiter im Forschungsbereich Gesundheitspolitik und Systemanalysen des WIdO. Die Ergebnisse deckten sich mit denen anderer Studien und Befragungen, wonach bei Kindern von Alleinerziehenden eine niedrigere gesundheitsbezogene Lebensqualität und mehr psychische Probleme beobachtet wurden.
Viele Kinder konnten seit Beginn der Pandemie die Angebote der (vor)schulischen Bildung, Betreuung und Erziehung nur selten oder unregelmäßig nutzen. „Nun gilt es, die pandemiebedingten Belastungen zu bewältigen und Versäumtes nach- oder aufzuholen“, so Zok. Die meisten befragten Mütter wünschen sich hierfür Unterstützung durch Sportvereine (27,8 Prozent), gefolgt von Schulpsychologen und Sozialarbeitern (24,8 Prozent). Mütter mit niedrigem sozialem Status formulierten überdurchschnittlich häufig Bedarfe hinsichtlich Nachhilfe- und Lerngruppen. Nur ein knappes Drittel wünscht sich keinerlei Unterstützung. Überdurchschnittlich hoch ist dieser Anteil in der Gruppe, die mutmaßlich einen höheren Bedarf an Unterstützung hat, also bei Müttern mit einfacher Bildung (34,9 Prozent) und geringem Haushaltseinkommen (32,8 Prozent). „Das lässt befürchten, dass bestehende Versorgungsangebote ausgerechnet diejenigen Kinder nicht adäquat erreichen, die ein sehr hohes Risiko für pandemiebedingte Belastungen und mögliche Folgeerkrankungen haben“, so Klaus Zok. Viele dieser Angebote seien darauf ausgerichtet, dass Eltern die Initiative ergreifen und Hilfe für ihre Kinder aktiv nachfragen.
Die Mehrheit der befragten Mütter hat sich vor allem durch den während der Pandemie eingeschränkten Kindergarten- und Schulbetrieb stark oder sehr stark belastet gefühlt (65,2 Prozent), insbesondere die Alleinerziehenden mit 69,6 Prozent. Es zeigen sich auch hier deutliche soziale Unterschiede: So gaben Mütter mit niedrigem Haushaltseinkommen sowie Alleinerziehende häufiger starke oder sehr starke Belastungen an. Dies ist offenbar nicht ohne Folgen für das Familienleben geblieben. Fast jede zweite Mutter berichtet von einer Zunahme familiärer Meinungsverschiedenheiten seit Pandemiebeginn. Das betrifft sowohl kleinere Probleme, wie nervige Diskussionen (47,6 Prozent) als auch gravierende Vorfälle wie lauten Streit oder Handgreiflichkeiten (30,9 Prozent). Auch hier zeigten sich jeweils höhere Werte bei Geringverdienerinnen, Alleinerziehenden und bei Müttern, die mit ihren Kindern auf weniger als 20 Quadratmeter Wohnfläche je Person leben.
Aber die Pandemie hat nicht nur negative Auswirkungen auf die Familien. So berichten mehr als zwei Drittel der Mütter (73,1 Prozent), dass das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Familie gewachsen sei. „Die positiven Pandemie-Effekte wie der gestärkte familiäre Zusammenhalt oder das Entdecken neuer, gemeinsamer Hobbys wurden jedoch in sozial schwächeren Familien deutlich seltener wahrgenommen“, so Zok.
Kinder sind reizbarer und aggressiver geworden
Wie hat sich der Corona-Stress nun ganz konkret im Verhalten der Kinder und Jugendlichen bemerkbar gemacht? Mehr als jede zweite Mutter (56,3 Prozent) benennt Auffälligkeiten, die mit den pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen in Verbindung stehen könnten. Reizbarkeit und Aggressivität (36,5 Prozent) stehen dabei mit Abstand an erster Stelle. Rund ein Viertel der Befragten gibt Antriebsmangel (25,3 Prozent), Ängstlichkeit (24,5 Prozent), gedrückte Stimmung (23,8 Prozent) sowie starke Unruhe (23,1 Prozent) an. Generell findet jede fünfte Mutter, dass ihr Nachwuchs seit dem Beginn der Pandemie reizbarer und aggressiver geworden ist. Als ungünstige Auswirkungen der Pandemiemaßnahmen auf ihre Kinder geben die Mütter vor allem einen übermäßigen Medienkonsum (74,4 Prozent) und Bewegungsmangel (63,2 Prozent) an. Bei übergewichtigen Kindern haben sich in vier Fünftel aller Fälle die Gewichtsprobleme während der Pandemie verschärft, bei Kindern aus Familien mit niedrigem Einkommen sogar in über neun Zehntel der Fälle. Auch hier zeigt sich ein deutlicher Sozialgradient: Mütter mit einfacher Schulbildung, geringem Haushaltseinkommen und Alleinerziehende berichten viel häufiger von gesundheitsgefährdendem Verhalten ihrer Kinder sowie ungünstigen Auswirkungen der Pandemiemaßnahmen als der Durchschnitt. Rund elf Prozent der befragten Mütter geben an, dass ein Arzt oder Psychotherapeut bei ihrem Kind eine psychische Erkrankung diagnostiziert habe. Eine Empfehlung für eine psychotherapeutische Behandlung wurde für Kinder von Alleinerziehenden sowie Müttern mit einfacher Schulbildung oder geringem Einkommen häufiger ausgesprochen.
Mehr Infos im Internet: https://www.wido.de/publikationen-produkte/widomonitor/widomonitor-1-2022/
AOK-Bundesverband GbR
Rosenthaler Straße 31
10178 Berlin
Telefon: +49 (30) 34646-0
Telefax: +49 (30) 34646-2502
http://www.aok-bv.de
Telefon: +49 (30) 34646-2211
E-Mail: presse@bv.aok.de
![]()