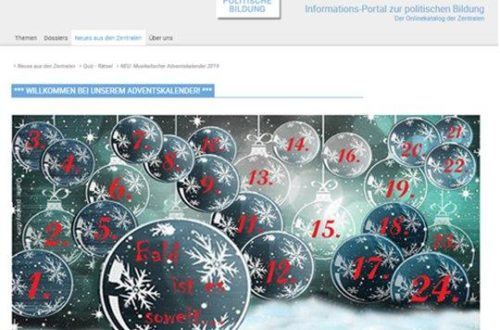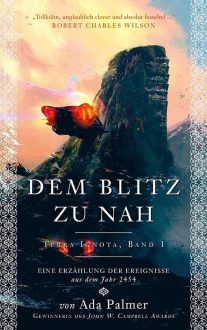Unsichere Zukunft, sichere Gegenwart und die Liebe zu Irland sowie zu Elena aus Baltimore – Fünf E-Books von Freitag bis Freitag zum Sonderpreis
So oder so aber wird er die Nr. 1 des Jahrgangs 2021 bleiben, der Erstgeborene gewissermaßen oder auch der Erstveröffentlichte. Das ist eine seiner offensichtlichen Besonderheiten, die ihm auch zukünftig keiner mehr nehmen kann. Aber ihn zeichnen noch zwei weitere Besonderheiten aus: So ist dieser Newsletter, was nicht alle Wochen, sondern eher selten vorkommt, ganz einem einzigen Schriftsteller gewidmet. Und dieser erste Newsletter des neuen, noch ganz jungen und wie man so schön zu sagen pflegt unschuldigen Jahres, dieser erste Newsletter 2021 ist ein Geburtstags-Newsletter oder vielleicht ein Vor-Geburtstags-Newsletter. Walter Kaufmann, der diesmal alle hier und heute präsentierten fünf aktuellen Angebote geschrieben hat, die wie immer eine Woche lang zum Sonderpreis im E-Book-Shop www.edition-digital.de (Freitag, 01.01. 21 – Freitag, 08.01. 21) zu haben sind, ist auf dem besten Wege, 100 Jahre alt zu werden – und zwar am 19. Januar 2024. Demzufolge wird er in wenigen Tagen 97 Jahre alt. Happy Birthday, Walter Kaufmann!
Und was wünscht sich eigentlich ein Schriftsteller zu seinem Geburtstag am meisten? Klar, dass er gelesen wird, dass er möglichst viel gelesen wird. Und wer sich erstmals oder auch wieder mit den Texten von Walter Kaufmann, aber auch mit seinem bewegten, kämpferischen und sich immer wieder verändertem Leben vertraut machen möchte und auf diese Weise ein Jahrhundert besichtigen will, der darf sich heute über ein spannende Auswahl seiner Bücher in einem 5er Paket freuen – zum Sonderpreis.
Viele autobiographische Bezüge des im Todesjahr von Lenin in Berlin als Sohn einer jüdischen Verkäuferin geborenen und 1926 von einem jüdischen Anwaltsehepaar in Duisburg adoptierten Jizchak Schmeidler – so sein eigentlicher, wirklicher Name – präsentiert die Erzählung „Unter australischer Sonne“- Australien war und ist ein wichtiges Thema seines Lebens. Schließlich hat er dort fast zwei Jahrzehnte verbracht, nicht immer einfache Jahre …
Auf die Spur einer vielköpfigen liebenswerten katholischen Familie begibt sich Walter Kaufmann in „Irische Reise“. Mit und zu Irland verbindet den viel- und weitgereisten Autor eine große Liebe.
Um die existenzielle Entscheidung eines Schriftstellers geht es in Flucht – und auch in diesem Falle um eine plötzliche, große Liebe.
Bewegende Zeugnisse der langen Lebensreise des Autors im Fluss der Zeit stellt „Ein jegliches hat seine Zeit. Wiederbegegnungen auf drei Kontinenten“ vor. Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Und da hat die Literatur schon immer ein gewichtiges Wort mitzureden und heute erst recht. Das heutige Angebot präsentiert ein langes und kämpferisches, schon mehr als neun Jahrzehnte währendes und damit gewissermaßen ein biblisches Maß erreichendes Leben eines Mannes, der zum Glück nicht nur überlebt, sondern auch viel erlebt hat und der weiß, wie es ist, wegen seiner Herkunft und wegen seiner progressiven politischen Überzeugungen angegriffen zu werden. Und gerade heute, wo es leider wieder in Mode zu kommen scheint, Menschen eben wegen ihrer Herkunft oder wegen ihrer progressiven politischen Überzeugungen offline wie online zu beschimpfen und zu bedrohen, sie körperlich anzugreifen und sogar umzubringen, ist es gut, ein solches starkes Erinnerungsbuch zu haben – zum einen, weil man sich erinnert, dass es solche Tendenzen nicht nur in der deutschen Geschichte schon einmal gegeben hat. Und zum anderen, weil diese Erinnerungen auch Kraft und Mut machen, sich selbst zu wehren und Solidarität mit allen jenen zu üben, die heute wieder bedroht und beschimpft und ausgegrenzt werden. Wehret den Anfängen! Oder sind wir vielleicht schon einen Schritt weiter? Jedenfalls darf man sich nichts gefallen lassen. Vor allem das nicht.
Erstmal 1977 erschien im VEB F. A. Brockhaus Verlag Leipzig 1977 „Wir lachen, weil wir weinen. Im Brennpunkt: Nordirland“ von Walter Kaufmann (Redaktionsschluss war am 15.11.1976). Wie der Verfasser zu Beginn anmerkt, wurden „Aus begreiflichen Gründen … verschiedene Eigennamen verändert“. Gewidmet ist dieses Buch „James Stewart. Belfast“: „We laugh because we cry” – „Wir lachen, weil wir weinen“ – so lautet ein irisches Sprichwort, das in all seiner Knappheit Charakteristisches über Irland und die Iren aussagt. Dem in jahrhundertelanger Unterdrückung durch die Engländer erfahrenen Leid, aber auch dem unbeugsamen Lebenswillen des irischen Volkes spürt Walter Kaufmann in seinem Buch von 1975 nach. In seinen Reportagen kommt seine Liebe zu diesem Land zum Ausdruck, nehmen Menschen Nordirlands Gestalt an: Iren und Engländer, Katholiken und Protestanten, Männer der IRA und Männer der UVF, Kommunisten und Kapitalisten. Ihre Schicksale – stellvertretend für das Schicksal ganz Nordirlands – machen uns die inneren Widersprüche des leidgeprüften Landes und die scheinbare Ausweglosigkeit deutlich, lassen uns den blutigen Alltag ungleich stärker nacherleben als das lapidare Zeitungsmeldungen vermögen. Sein Leben unter Hafenarbeitern und Seeleuten während seines siebzehnjährigen Australienaufenthaltes machte Walter Kaufmann schon in den Kriegs- und ersten Nachkriegsjahren mit der irischen Art vertraut. Der Freiheitsdrang von Einwanderern aus Belfast und Derry, denen er in den Häfen von Sydney und Melbourne und in der Inselwelt des Pazifischen Ozeans begegnete, ihre selbstverständliche Solidarität mit allen Unterdrückten, ihr Humor und ihre Herzlichkeit beeindruckten ihn sehr. Für die bildhafte kraftvolle Sprache dieser Männer entwickelte er ein waches Ohr, ihm war, als blättere er in den Werken von O´Flaherty, O´Casey und Synge, die von jeher einen bedeutenden Einfluss auf sein Schaffen hatten. Diesem Einfluss hat sich Walter Kaufmann nie entziehen wollen, und so war es nur folgerichtig, dass er bei Reisen in Nordirland 1975 seine Bindung zum irischen Leben vertiefte und hier mit besonderem Engagement sein Thema fand. Hier ein eindrucksvoller Auszug, der Einblicke in das Buch wie in die damalige Situation Nordirlands gibt:
„Bis zu jenem verhängnisvollen Augenblick, den auch er – wie sich später herausstellte – nur um Minuten verpasst hatte, war die Bush Bar eine Art Arbeiterbörse für Jack O’Malley. Dort trank er nicht nur seinen Guinness in geselliger Gemeinschaft von IRA-Männern, sondern holte sich auch Aufträge und heuerte erwerbslose Arbeiter an, die ihm für ein paar Pfund als Beifahrer zur Hand gingen. Schon im Frühjahr hatte es mich in diese Kneipe gezogen, eine Fundgrube für Informationen; ich war aber damals dem hochgewachsenen, breitschultrigen Mann nicht nähergekommen, der da, stets am gleichen Platz, den James-Connolly- und Che-Guevara-Bildern gegenüber, die neben den Flaschenregalen hingen, trinkend an der Theke lehnte. Erst im Sommer entstand zwischen uns eine jener für dieses Land typischen Männerbeziehungen, die gleich stürmisch-herzlich beginnen und sich an Whisky und gegenseitigen Offenbarungen weiter entfachen. Er erfuhr viel von mir, und darum zögerte er auch nicht, so manches aus seiner eigenen Vergangenheit preiszugeben, was er normalerweise verschwiegen hätte. Sicher half dabei auch, dass wir beide etliche Seefahrtsjahre hinter uns hatten und uns über ferne Häfen und Schiffsrouten rund um die Welt austauschen konnten. Wie so viele Iren erwies er sich als geborener Erzähler mit urwüchsigem Humor. Das Galgenstück, wie er und der Schiffsheizer Patrick Rooney in Amerika zwanzigtausend Dollar ergatterten, zeigt treffend, aus welchem Holz er geschnitzt ist:
„Wie wir zu dem Zaster gekommen sind? Mann Gottes, das war so … Da lag der alte Patrick stockbesoffen mit zerschmettertem Bein auf den Schienen im Hafengelände von Hoboken, seine Schuld durchweg, und ohne diesen pfiffigen Winkeladvokaten Sam Goldblatt wäre aus einer Versicherungsentschädigung nie was geworden. Der aber hatte rausgekriegt, dass der Lokführer schon drei Tage vor dem Unfall im Ruhestand war und keinen Dienst mehr hätte machen dürfen. Da hakte Goldblatt ein. Die Gerichtsverhandlung war das reinste Panoptikum. Der alte Patrick in kurzen Hosen, damit sein Gipsbein auch auffiel, und ich als Zeuge, obwohl ich in der Dunkelheit und meinem Suff überhaupt nicht gesehen hatte, wie mein Kumpel unter die Räder kam. Mit jedem Meineid verschrieb ich meine Seele dem Teufel ein Stück mehr, und am Ende war die Versicherung froh, dass sie so billig davonkam, denn Sam Goldblatt hatte wegen Fahrlässigkeit der Bahnbehörden auf fünfzigtausend Dollar geklagt, sich dann mit der Hälfte abgefunden und fünftausend davon eingestrichen. Machte zwanzigtausend für uns, genug, um den Reeder zu feuern und die Welt zu kaufen. Zwanzigtausend Dollar – das war damals ein Stück Geld, kann ich dir sagen! Hätte sich der alte Patrick nicht gleich wieder besoffen und – Pech im Glück! – den gesunden Fuß so verstaucht, dass er überhaupt nicht mehr laufen konnte, dann wäre das Ganze der Witz des Jahres gewesen. Was soll’s – war auch so sehr lustig, wie wir beide den Zaster niedergekniet haben. Du glaubst das alles nicht? Mann Gottes, der alte Patrick lebt nur ein paar Straßen weg von hier, wir können ihn ja holen.”
Darauf bestand ich nicht. Todsicher hätte der Schiffsheizer jedes Wort bestätigt, und mir wäre es immer noch überlassen geblieben, den Funken Wahrheit in der Geschichte zu erkennen. Großzügig bestellte Jack noch zwei doppelte Whisky und erzählte weiter. Mit jedem neuen Mosaikstein kam die wilde, ungezügelte Art dieses etwa vierzigjährigen Vaters von sieben Kindern und Ehemanns einer deutschen Frau deutlich zutage. Deutschland, besonders Hamburg und Lübeck, spielten im Folgenden eine beträchtliche Rolle. Dorthin hatte es ihn später verschlagen, dort hatte er Agnes Schmidtchen kennengelernt und geheiratet, und von dort war er schließlich wieder ausgerückt, nachdem er sich „für die gute Sache natürlich!” in Altona Unmengen von Falschgeld hatte drucken lassen -im Namen der lRA, die dahintergekommen war, dass die Nazis im Krieg Millionen englischer Pfund produziert hatten, um die britische Wirtschaft zu stören. Eine Mordsidee, hatte Jack O’Malley gefunden: die britische Wirtschaft in die Knie zwingen und so der Heimat nützen! Doch das Unternehmen schlug fehl, ein Komplize von ihm wurde mit dreitausend Pfund Falschgeld an der britischen Grenze verhaftet, und Jack O’Malley, der mit weit mehr bis nach Belfast durchgekommen war, sah sich gezwungen, den Großteil seiner Beute zu vernichten.
„Mann Gottes, hätte ich bloß auch den Rest verbrannt! Die paar Lappen, die sie dann bei dieser wüsten Hausdurchsuchung bei mir fanden, haben mich vier Jahre hinter Gittern gekostet. Noch einen Whisky – was soll’s! Die lumpigen Jährchen hab’ ich eben abgerissen, auf einem Ohr sozusagen, für die gute Sache und für Irland!”´ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses ersten Newsletters des neuen Jahres, die wie schon angemerkt alle fünf von einem einzigen, in seinem langen Leben allerdings auch sehr produktiven Autor stammen:
Erstmals 1965 veröffentlichte Walter Kaufmann im Deutschen Militärverlag Berlin die Erzählung „Unter australischer Sonne“, die 1957 bereits in dem Buch „Wohin der Mensch gehört“ gedruckt wurde und seiner Frau Barbara gewidmet ist: Stefan, der jugendliche jüdische Emigrant, der nach England fliehen konnte, wird als Kriegsgefangener nach Australien deportiert. Nach dem eintönigen Lagerleben arbeitet er als Obstpflücker und meldet sich als Freiwilliger zur australischen Armee, wo er vor allem im Hafen arbeiten muss. Welche Fülle von Erlebnissen und Begebenheiten der neue Kontinent für ihn birgt, davon erzählt dieser Roman. Viele Menschen treten in Stefans Leben: Da ist Albert, der Freund aus Deutschland, der dem verzweifelten Emigranten beratend zur Seite steht, da sind Bill und Jack, australische Arbeiter, die ihm weiterhelfen, da ist vor allem Ruth, die Stefan in aufrichtiger Liebe auf seinem schicksalhaften Wege folgt. Hören wir von Stefan:
„Vor gut anderthalb Jahren, als holländische Matrosen ihn in Rotterdam einem Flüchtlings-Hilfskomitee übergaben, hatte Stefan angefangen zu lernen, dass es nutzlos war, die immer ungewisser werdende Zukunft ergründen zu wollen; und dass man sich am besten an die Gegenwart hielt. Für ein paar Wochen war er in der Familie eines holländischen Schlepperkapitäns aufgenommen worden, bei freundlichen, großzügigen Leuten, die seinen kurzen Aufenthalt zum Mittelpunkt ihres Lebens gemacht hatten. Offen, wie sie in allem waren, breiteten sie jedoch ein eisernes Schweigen über die einzige Verbindung zu seiner Vergangenheit, die Stefan in Holland erwartet hatte: über Gerhart und Hilde. Auch verschwiegen sie, wie ein Brief an seine Mutter über die deutsche Grenze und eine Antwort zurück geschmuggelt wurden. „Vater ist aus Dachau entlassen. Wir bemühen uns um Ausreise nach Amerika. Wir wünschen dir alles Gute, lieber Sohn.“
Der Ausbruch des Krieges traf ihn in einem Flüchtlingslager auf den Kanalinseln; unmittelbar vor den eindringenden Deutschen wurde er nach England evakuiert, wo er bald darauf gleich ungezählten anderen Flüchtlingen aus Nazideutschland interniert wurde. Die Welt hinter Stacheldraht war eine Welt für sich, abgeschlossen, unwirklich; voller Gerüchte, voll von Unbefriedigung und Ungewissheit und nach dem Debakel von Dünkirchen erfüllt von der Furcht vor der Ankunft der Faschisten. Im Lager schien es Stefan, die Eltern wären weiter weg denn je, entschwunden in eine große Leere, und es gab Augenblicke, da er all seinen lebhaften Erinnerungen zum Trotz die Eltern tot glaubte und sich als Waise fühlte. So lebte er von einem Tag zum anderen in einem Zustand, der an Apathie grenzte, so dass er es gleichgültig hinnahm, als er mit zweitausend anderen Deutschen zur weiteren Evakuierung per Schiff mit unbekanntem Ziel bestimmt wurde, gleichgültiger als früher eine versäumte Verabredung oder ein nicht eingehaltenes Versprechen. Er wurde zu einer Nummer, der Nummer 56 23 00, die Essen brauchte, Kleidung und zum Schlafen einen Strohsack oder, wie während der beiden Monate Fahrt durch verminte Gewässer, eine Hängematte in dem überfüllten düsteren Lastraum eines umgebauten Trampdampfers, der sie nach Australien brachte.
Aus seiner Schulzeit kannte er Australien als einen ungeheuren, zumeist unfruchtbaren Kontinent, die Einöde hier und da von einer Schaffarm mit artesischen Brunnen unterbrochen, als einen Kontinent, der unsicher war wegen seiner wilden Hunde und durch die Anwesenheit von schwarzen Eingeborenen und merkwürdig wegen der Kängurus und Platypi genannten amphibischen Säugetiere, die Eier legten und einen Schnabel hatten. Wie jemand, der zu einem Reisefilm über seltsame Länder ins Kino geht, hatte er das Land seiner Schülervorstellung zu sehen erwartet, so dass ihm die schimmernde Großstadt am Horizont hinter den Hafenschuppen wie ein Betrug vorkam.
Unter dem Gebrüll von Befehlen hatte sich der Zug mit menschlicher Fracht gefüllt, das Schiff am Kai war weit aus dem Wasser emporgestiegen. Die Sonne sank hinter die Schuppen, wo Hafenarbeiter mit Schiebkarren Wollballen auf Frachtdampfer verluden. Schließlich tönte eine Dampfpfeife, die Puffer klirrten, die Waggons ruckten und rollten dann vom Kai durch die Stadt Sydney, die grau wurde und bald ihren Glanz verlor. Der Zug hastete an Höfen vorüber, wo zwischen wirbelndem Rauch Wäsche flatterte. Kinder starrten aus den Fenstern verrußter Reihenhäuser, die Stefan an alle Elendsviertel erinnerten, die er in Deutschland, Holland und England gesehen hatte. Bald wurden der Wohnhäuser weniger, und nach kaum mehr als einer Stunde breitete sich Land, das wirklich den Seiten seines Geografhiebuch entstiegen zu sein schien, die von Australien handelten: weite Ebene, hier und dort knorrige nackte Bäume und verstaubtes Gesträuch, das in die Abenddämmerung überging.
Ebenso wenig wie Stefan und Albert versuchten andere, ihren neuen Eindrücken in Worten Ausdruck zu geben. Monoton ratterten die Räder, schwankte der Waggon. Die Beine weit auseinander, lehnten die Posten an jeder Tür auf ihren Gewehren, die Blusen am Halse geöffnet, die Hüte zurückgeschoben, Zigarettenstummel im Mundwinkel. Stumm betrachteten sie ihre Gefangenen, die ihnen schlecht ernährt und zum größten Teil überraschend jung und harmlos vorkamen. Wenn ihr Hitlersoldaten seid, schienen die Mienen der Bewacher zu sagen, ist der Krieg in vier Wochen vorbei!
Der Soldat neben Stefan, ein hagerer Fünfziger mit knochigem Gesicht und drahtigen Augenbrauen, setzte sich schließlich ihm gegenüber. Er hielt sein Gewehr achtlos wie einen Stock, streckte die Beine aus und fragte lässig: „Wo haben sie dich gefangen, Kamerad?“
Stefan fuhr zusammen. Es war das erste Mal seit seiner Internierung, dass jemand in Uniform ihn anredete.
„Sprichst du Australisch?“
„Englisch?“, fragte Stefan. „Ein wenig.“
„Na also. Wo haben sie dich geschnappt?“ Der Posten blinzelte ungeduldig mit den grauen Augen. Stefan schüttelte den Kopf. „Ist gut, ist egal. Einer von der Hitlerbande?“
„Nein“, sagte Stefan entschieden, „ich bin Flüchtling.“
„Oh“, sagte der Posten. „Und deine cobbers?“
„Sie auch“, antwortete Stefan. Obgleich er nicht wusste; was ein cobber ist, bezog er es auf die andern.
„Was tut ihr dann hier? Hat doch keinen Sinn, euch einzusperren. Wir meinten, ihr wärt alle Kriegsgefangene.“
Stimme und Augen des Postens wurden freundlicher, als er nach und nach erfuhr, wo Stefan herkam und wo seine Eltern waren.“
Erstmals 1979 veröffentlichte Walter Kaufmann das für Leser ab 12 gedachte Kinderbuch „Irische Reise“: Ein Sack Saatkartoffeln im kleinen Hafen von Bunbeg verrät es: Noch ist die Familie Kelly nicht umgezogen auf die kleine raue, fast verlassene Insel an der irischen Westküste, noch muss sie in ihrem Häuschen im Norden zu finden sein. Walter Kaufmann begibt sich auf die Spur dieser vielköpfigen liebenswerten katholischen Familie und begleitet sie in ihr neues Zuhause. Hochzeit in Dundalk: Guinness, das schmackhafte schwarze Bier, Musik, Gesang, Geselligkeit. Sehen Hochzeiten in Irland nicht immer so aus? Nur hier im Süden ist diese Hochzeit möglich, ohne Schüsse oder Bomben fürchten zu müssen: denn die Braut ist katholisch, der Bräutigam Protestant. „Kein Grund zur Besorgnis, wenn hier Landminen lägen, wäre ich der Erste, der es erfährt. Die werden doch nicht ihren Tierarzt opfern“, sagt Doc Flannagan. Aber ohne ihn hätte dieser Abstecher in den nordirischen Grenzort, wo gerade wieder einmal ein britischer Offizier entführt und ermordet wurde, ein böses Ende finden können. Abenteuerlust und Liebe zu diesem Land führten Walter Kaufmann 1977 quer durch die grüne Insel Irland. Hier einige Eindrücke von dieser Reise:
„2
Meiner Reise nach Carrickfergus waren etliche Tage in Belfast vorangegangen, irische Sommertage, mild und hell und sonnig bis in die späten Nächte, wenn mit den Schatten über den Bergen die mitternächtliche Stunde nahte und es allmählich dunkelte.
Belfast hatte sich mir in noch ärgerer Bedrängnis gezeigt als vor zwei Jahren. Die britischen Soldaten wirkten schroffer, autoritärer, schienen die Bevölkerung mehr noch als zuvor unter der Knute zu haben. Nach sechs Uhr abends lag die Innenstadt wie ausgestorben, der Autoverkehr war abgewürgt, die Schlagbäume in der High Street waren festgekettet, nur noch wenige Fußgänger bewegten sich im Umkreis des Rathauses wie verirrte Statisten inmitten von Kulissen. Keine Busse fuhren mehr ins Zentrum, keine Taxis, und an allen Ecken wachten britische Soldaten mit Maschinenpistolen, Männer mit kugelsicheren Visieren vor den Gesichtern und Wachhunden an den Leinen. Das Hotel, in dem ich einst gewohnt hatte, wurde zum Verkauf angeboten – wer würde es kaufen? Denn tot lag auch die Royal Avenue im abendlichen Sonnenschein, so tot und verlassen bis hin zum Donegall Square, dass sich Neil Fagin quer aufs Pflaster warf und dort lange liegenblieb, die Arme und Beine ausgestreckt. „Hier ruhst du wie in Abrahams Schoß!“ Tatsächlich, kein Fahrzeug überrollte ihn, auch nicht die Jeeps der britischen Armee. Die Soldaten lehnten an den Wänden und sahen belustigt zu – ein Irrer, dachten sie wohl. Was ihnen nicht einmal zu verübeln war, denn wild und unberechenbar und ungezügelt hatte sich Neil Fagin schon gezeigt, als wir uns vor langer Zeit in einer Studentenkneipe kennenlernten.
Bald dröhnte tief über den Dächern ein Hubschrauber, die Besatzung in der Glaskanzel wirkte zum Greifen nah und war dann plötzlich nicht mehr auszumachen hinter dem Tiefstrahler, der am Rumpf des Flugzeugs aufleuchtete. Ein greller Lichtkegel fuhr über Neil Fagins Gesicht, er musste die Augen schließen, die Hände vor die Augen werfen, dann sprang er auf die Füße, reckte die Faust zum Himmel und schrie: „Jesus Christ Superstar – hab Erbarmen mit Belfast!“
Es war der Abend eines Mittwochs im Mai, so wie damals, als ich zum ersten Mal in diese Stadt gekommen war und das brennende Auto gesehen hatte, die Trümmer der Gettos in der Innenstadt. Seit wann aber kreiste der Hubschrauber über der Stadt, täglich, nächtlich, der Tiefstrahler am Rumpf gleißender als die Sonne, die Sterne und der Mond? Seit wann hatten sich die Militärkontrollen verschärft, war die Belagerung massiver geworden? Wahrlich, bisher hatte kein Gott Erbarmen mit Belfast gezeigt. Wie eh und je waren die protestantischen Viertel durch Drahtverhaue, Mauern und hohe Zäune von den katholischen getrennt. Und der junge Kieran Macnamara, den ich vor zwei Jahren im Internierungslager Long Kesh hatte aufsuchen wollen, wohin man ihn unter dem Verdacht illegalen Widerstands verbannt hatte, war noch immer nicht in sein Elternhaus in der Leeson Street zurückgekehrt. Er saß nun in verschärfter Haft, bekleidet nur mit Decken, weil er sich geweigert hatte, Sträflingskleidung anzuziehen: „Niemals – ich bin ein Freiheitskämpfer und kein Strauchdieb!“
Tage in Belfast – Glenveagh Drive und Clifton Street, Cavehill Road und The Shankill, Mayo Street und Oldpark Avenue, in diesen Straßen wohnten jene Männer, deren Kehlen zerschnitten wurden von einem rasenden Fabrikarbeiter namens William Moore, der jetzt vor dem Richter steht, angeklagt wegen neunfachen Mordes, ein hagerer Mann von zweiundzwanzig, unrasiert und mit trübem Blick.
In den nahen Kneipen schütteln die Männer die Köpfe, wenden den Blick ab, ziehen die Schultern ein, während der Sprecher im Rundfunk die Namen der Toten verliest – Francis Crossan, Thomas Quinn, Dominic Rice, Francis Cassidy, Edward McQuaid, Cornelius Neeson, Joseph Morrisey, Edward McClafferty.
Grauenvolleres hatte es in diesem Krieg der Bürger von Belfast noch nicht gegeben – neun Männer hinterrücks ums Leben gebracht, acht davon Katholiken. Nur Noel Shaw, achtzehn Jahre alt und Protestant, hatte sein Ende durch Gewehrkugeln gefunden, war tot in einem Wäschekorb aufgefunden worden. Womöglich zählte er gar nicht zu den Opfern dieses William Moore, der mit Messer und Beil gegen Katholiken zu Werke gegangen war.
Es ist düster im Gerichtsgebäude, draußen aber, über der Stadt, strahlt weiterhin die Sonne, ein lauer Wind streicht über die Berge und das blaue Meer, Sommerblumen blühen, und die Wiesen glänzen saftig grün.
In der Agrarausstellung im Vorort Balmoral lächeln die Schönheitsköniginnen, lassen sich zwischen Mähdreschern, Traktoren und Preisbullen fotografieren, Kinder reiten auf Ponys, Whisky fließt frei hinter Theken, und in Smithfield, im Zentrum von Belfast, rücken die Markthändler ihre Stände in die Sonne. Der pfiffige Sean Flynn, blond, blauäugig und flink, dem ich nur Tage später in einer Hafenkneipe von Carrickfergus wiederbegegne, setzt für teures Geld billigen Schmuck ab. „Kauft, liebe Leute, kauft schnell, bevor die Polizei kommt!“ Auch Füller, die nichts taugen, gehen weg, denn Sean beherrscht den Trick, ihre Federn auf den Tisch zu schlagen, ohne sie zu beschädigen. „Seht her, was diese Füller aushalten!“ – und krach! Die Feder verschwindet in der geballten Faust.
Die Geschäfte rings um den Markt öffnen ihre Türen weit, und die Angestellten am Eingang schauen nur flüchtig in die Taschen der Hausfrauen. „Keine Bomben, meine Damen – natürlich nicht!“
Im Reporterzimmer des „Sunday Call“, wohin es mich aus alter Verbundenheit verschlagen hat (schließlich war ich einmal unter abenteuerlichen Umständen für dieses nordirische Massenblatt als Reporter tätig), schrillen wie immer die Telefone. Die blonde Beatrice Cleaver, verheiratet inzwischen, hat jetzt eine Kollegin zur Seite, ist nicht mehr wie früher Henne im Korb, auch Colin McCausland hat geheiratet – in ein paar Wochen will er mit Frau und Kind nach Kalifornien auswandern, was bedeutet, dass Warren Messenger und Peter Fielding aufrücken werden.
Wie damals, so auch heute hilft mir Alex McMurray, der stellvertretende Chefredakteur, im Lande Fuß zu fassen und kommt nach kurzem Nachdenken auf eine Idee: „Wie wär’s mit ein paar Wochen auf Owey Island?“- Was soll das hergeben, will ich wissen, und er berichtet von einer katholischen Familie aus Carrickfergus, die sich wegen der Gewalttätigkeiten in Nordirland auf diese Insel in der Republik Irland abgesetzt haben soll. Und schon telefoniert er, holt Informationen ein, findet heraus, dass im kleinen Hafen von Bunbeg, an der Küste von Donegal, noch ein Sack Saatkartoffeln für die Familie Kelly liegt, was heißt, dass die Kellys noch nicht auf der Insel sein können. Ob sie in den harten Wintermonaten aufgegeben haben und zurück nach Carrickfergus sind? Auch das will Alex McMurray noch erkunden, in wenigen Tagen schon – „bis dann nimm’s leicht und mach dir ein fröhliches Wochenende.“´
Erstmals 1984 druckte der Mitteldeutsche Verlag Halle-Leipzig „Flucht“ von Walter Kaufmann: Dies ist die Geschichte eines Schriftstellers, der sich vor eine schwierige Entscheidung gestellt sieht. Was er vor Jahren im australischen Exil erträumt und was er schließlich nach seiner Rückkehr gefunden hatte: eine Familie, einen Freund, Heimat, all dies steht plötzlich in Frage. Er verliebt sich in Elena, die schwarze Sängerin aus Baltimore, gibt ihretwegen Bettina und die Töchter auf. Soll er mit Elena das Land verlassen, das ihm Heimat zu werden begann? Hartmut, der Freund, angesehener Chefarzt, verlässt seine Heimat. Die Suche nach den Gründen für dessen Flucht wird zur Suche nach sich selbst – nach Familie, Freundschaft, Heimat. Und so beginnen das Buch und die im besten Sinne des Wortes merkwürdige Liebesgeschichte, die Liebesgeschichte des Schriftstellers und Elena aus Baltimore:
„1.
Zumindest betäubte die Hektik jener Wochen mein Bewusstsein, dass ich tief in einer Krise steckte. Wegen Elena Crawford, einer schwarzen Sängerin aus Baltimore, die damals im Lindencorso gastierte, gab ich alles preis, was ich in den langen Jahren der Emigration in Australien ersehnt und erst nach meiner Rückkehr gefunden hatte – ich trennte mich von der Familie, von Bettina und den beiden Töchtern, Esther war damals erst zehn, Judith zwei Jahre jünger, und machte mich auf die Suche nach einer Wohnung in Berlin. Ausschau haltend nach gardinenlosen Fenstern, durchforschte ich die Straßen im Stadtinnern, und so fand ich schließlich eine leer stehende Mansarde, die mir dann auch, weil sie baufällig und schwer vermietbar war, kurzfristig zugewiesen wurde. Wenn ich dort ungestörter schreiben könnte und Redaktionen und Verlagen erreichbarer sei als in meinem Haus in Stahnsdorf, meinte der Leiter des Wohnungsamts, nun dann – mein Wille sei mein Himmelreich!
Der Einweisung folgte bald ein Vertrag, und wenige Wochen später waren die Räumlichkeiten von Grund auf renoviert und umgestaltet. Die relativ geräumige Besenkammer, die an die Innentoilette grenzte und über ein Fenster zum Hof verfügte, hatte sich durch den Einbau von Spülschrank und Herd in eine Kochnische verwandeln lassen. So konnte aus der Küche neben dem Wohnzimmer die altmodische Kochmaschine entfernt und dort eine Duschkabine installiert werden, die sich, in Holz verkleidet, wie ein Schrank in den jetzt in eine Schlafstube umfunktionierten Raum einpasste – eine Lösung, die von den vorangegangenen Mietern nie erwogen worden war, sich mir aber schon bei der Besichtigung als möglich angeboten hatte.
Das alles sagt zwar einiges über die Zielstrebigkeit aus, mit der ich die Veränderung meiner Umstände vorantrieb, lässt vielleicht auch die verzwickten Wege vermuten, die ich gehen musste, um die Handwerker und das nötige Material zu beschaffen, ganz sicher aber verrät der Aufwand nichts über meine innere Zerrissenheit, dieses Gefühl, etwas Beständiges, nie wieder zu Gewinnendes aufs Spiel gesetzt zu haben:
Ich bemühte mich, Elena meinen Zustand nicht spüren zu lassen, damals besonders! Aus gutem Grund verschonte ich sie, zog sie in meine Betriebsamkeit nicht hinein und ließ sie auf den Komfort ihres Hotels erst verzichten, als die Mansarde eingerichtet war, Gardinen hingen, Teppiche die frisch gehobelten Dielen bedeckten, Bilder die Wände schmückten, Bücher sich in den Regalen reihten und der Kachelofen wohlige Wärme verbreitete.
Bis dahin war der Herbst zur Neige gegangen, waren die Tage kühl und die Nächte kalt geworden. Und bis der Ofen funktionierte, hatte selbst ich nie länger in meiner neuen Bleibe ausgehalten als unbedingt nötig. Einen Großteil der Nächte war ich mehr in der Nachtbar zu finden gewesen, wo Elena sang, als zwischen den Wänden unterm Dach. So setzte sich ein Lebenswandel fort, der mit jenem Spätsommertag begonnen hatte, als ich mir von einer Zeitschrift den Auftrag holte, Elena auf ihrer bevorstehenden Konzertreise durch die Republik zu begleiten, um darüber zu schreiben. Unterwegs, von Stadt zu Stadt ziehend und in Hotels übernachtend, war mir für größere literarische Vorhaben keine Zeit geblieben – nur kurze, in sich geschlossene Prosastücke, die überschaubar waren, wollten mir damals gelingen, und so hatte sich meine Zerrissenheit mit einer schwelenden Unzufriedenheit in bezug auf meine Arbeit gepaart.
In diese Zeit fiel auch die Nacht, in der ich mich so wesensfremd verhielt, dass sich am Ende nicht nur Elena, sondern sogar die Kellner und die Barfrau besorgt zeigten. Ich verschleuderte Geld, auffallend viel, wie jeder sah, wohl an die siebenhundert Mark, hielt frei, wer freigehalten werden wollte, traktierte gegen Morgengrauen die Band des Lindencorsos mit einem Kasten Sekt und verteilte Trinkgelder wie ein Spieler nach dem großen Coup – und wirkte keinen Deut glücklich dabei.
„Was ist mit dir?“, fragte Elena, als sie sich nach der letzten, stürmisch erzwungenen Zugabe zu mir an den Tisch setzte, ein wenig atemlos noch und beseelt von jenem Glücksgefühl, das Beifall immer bei ihr auslöst. „Was hast du?“
„Ich zelebriere deinen Erfolg.“
„Beichte“, bat sie leise.
Ich brauchte nur zwei Worte hinzuzufügen, filthy lucre, um ihr begreiflich zu machen, dass ich Hartmuts Mercedes an den staatlichen Handel abgestoßen hatte und mit dem Erlös nichts Besseres anzufangen wusste, als ihn zu vergeuden – es war Geld, das mir auf den Nägeln brannte, weil es mir nicht zustand.
„Steck es in einen Umschlag und schick es ihm nach“, schlug sie vor.
„Als ob das ginge!“
„Dann vermach es irgendwem.“
„Wie du siehst, bin ich schon dabei.“
„Das kannst du einfacher haben“, sagte sie und hob dabei sanft lächelnd das kleine goldene Kreuz an, das sie an einem Kettchen am Hals trug.
Ich verstand sie sogleich. „Das fehlt noch, dass ich das Geld der Kirche spende.“
„Du könntest es auch dem Roten Kreuz lassen“, erwiderte sie. „Rot für dich, Kreuz für mich. Wäre doch eine Möglichkeit, oder?“
„Sicher“, gab ich zu, „und nicht einmal die schlechteste.“
Am nächsten Tag war der Betrag überwiesen – in bar, auf Heller und Pfennig genau die Summe, die nach der Nacht zuvor von dem Verkauf des Mercedes übrig geblieben war, 6230 Mark, kein Vermögen, aber auch nicht wenig. Immerhin hatte Hartmut den Wagen etliche Jahre genutzt, nachdem ich ihn aus Westberlin eingeführt hatte. Mein Manko waren die Postgebühren, eine Lappalie, und die Zeit, die ich für die Transaktionen beim staatlichen Handel aufgewendet hatte. Doch meine Erleichterung war nur von kurzer Dauer. Kaum kehrte ich von der Post in die Mansardenwohnung zurück, wurde ich erneut an das Fahrzeug erinnert. Es klingelte an der Tür, zwei Männer, die sich als Mitarbeiter der Staatssicherheit auswiesen, baten mit kühler Höflichkeit um eine Unterredung. Ich wusste Bescheid. Seit dem nun schon zehn Tage zurückliegenden Anruf von Hartmuts Sekretärin hatte ich diesen Besuch erwartet. Als ich den Männern das sagte, stutzten sie, schienen dann aber zu erkennen, dass ich ihnen nicht auswich, und nachdem sie mir bestätigt hatten, dass sie „Ganz richtig wegen der Republikflucht des Doktor Hartmut Berg“ zu mir gekommen seien, ließen sie mich zunächst einmal jenen Anruf erläutern.
„Schlicht und einfach die Auskunft, dass Doktor Berg mit seiner Familie die Republik verlassen habe und mich aus Westberlin grüßen ließ.“
„Teilte Ihnen die Sekretärin mit?“
„So ist es.“
Sie schwiegen und sahen mich an. Offensichtlich erwarteten sie mehr, und ich entschloss mich hinzuzufügen, dass es auch um den Mercedes gegangen sei, für dessen Nutzung mir Dr. Berg gedankt und den er in der Nähe meiner Wohnung abgestellt habe. Die dazu gehörenden Schlüssel, auch der Garagenschlüssel, wären unter einer Radkappe zu finden, und wenn ich so wollte, könnte ich die Garage übernehmen, deren Miete bis zum Jahresende bezahlt sei.
„Es war also Ihr Wagen?“
„Insofern, als ich ihn unter meinem Namen eingeführt und registriert hatte“, sagte ich. „Tatsächlich aber fuhr ihn nur Doktor Berg.“
Zu meinem Erstaunen gingen sie darauf nicht ein – es war, als wüssten sie das. Vorrangig interessiere im Augenblick, ob der Mercedes seit der Einfuhr je wieder über die Staatsgrenze gebracht worden sei.
„Von mir jedenfalls nicht“, sagte ich. „Was ja mühelos nachzuprüfen wäre.“
Zwar wollte mir nicht in den Kopf, dass sie mich verdächtigen könnten, Hartmut mit Frau und Tochter über die Grenze geschleust zu haben, doch dass sie vermuteten, der Wagen sei dazu missbraucht worden, lag auf der Hand. „Einfacher als das nachzuprüfen wäre es, wenn Sie uns für kurze Zeit die Schlüssel überließen.“
„Gern, wenn ich sie noch hätte – was aber seit ein paar Stunden nicht mehr zutrifft.“
„Tatsächlich!“ Meine Antwort ließ sie aufhorchen. „Wir verstanden Sie doch richtig, als Sie sagten, dass Sie den Mercedes nie wieder über die Grenze fuhren?“
„Ganz richtig.“
„Aber jetzt ist er weg, und Sie haben die Schlüssel nicht mehr.“
„Mein Gott“, sagte ich. „Wenn alles so einfach zu erklären wäre.“ Ich zog den Verkaufsvertrag vom staatlichen Handel aus der Innentasche meiner Jacke und zeigte ihn vor. „Dort wird er vermutlich noch sein.“
Ihre Mienen hellten sich auf. „Na also“, sagten sie, „gut für alle Beteiligten.“
„Ich fühle mich da kaum noch beteiligt“, erwiderte ich, froh, Hartmut den Mercedes, der ja ihm gehörte, nicht nach Westberlin gebracht zu haben. Mir war es recht, dass ihnen selbst nach längerer Pause nicht in den Sinn zu kommen schien, mich zu befragen, von wem das Fahrzeug bezahlt worden war. Warum sich darüber auslassen – schlafende Hunde soll man nicht wecken, ist eine angelsächsische Regel, und an die hielt ich mich. Weshalb sollte ich mich weiter mit einer Sache belasten, die mir bis zur Stunde, als ich den Mercedes endlich abgestoßen hatte, schon genug zu schaffen machte. Ungefragt jedenfalls würde ich auf die Gründe nicht eingehen, die mich damals bewogen hatten, Hartmuts Drängen nachzugeben und den Wagen für ihn einzuführen. So schwieg ich also und sagte nichts von jener pharmazeutischen Firma in Schweden, die ihm, wie Hartmut mir versichert hatte, den Mercedes auf dem Kulanzweg hatte zukommen lassen, nachdem ein von ihm entwickeltes Präparat über den Außenhandel der DDR zur Produktion an sie freigegeben worden war. Im Geiste hörte ich Hartmut wieder von dem Traumwagen schwärmen, der, „bedenk das mal!“, drüben schon etliche Monate herumstünde und verrottete.
„Ein jegliches hat seine Zeit. Wiederbegegnungen auf drei Kontinenten“ – so lautet der Titel des 1994 bei der edition q Verlags-GmbH Berlin erschienenen und Angela gewidmeten Buches. Worum es darum geht, das lässt sich im folgenden Auszug aus der Laudatio zur Verleihung des Literaturpreises Ruhrgebiet – Hauptpreis für das Lebenswerk – 1993 erfahren: Weitere bewegende Zeugnisse der Lebensreise des Autors im Fluss der Zeit: nach Jahrzehnten gesuchte erneute Begegnungen mit Menschen in Australien, Israel, den USA und Deutschland ebenso wie unfreiwillige „Schattenbegegnungen“ beim Studium seiner Stasi-Akten in Berlin. „In dieser meisterlichen Kurzprosa zeigt sich die Spannweite zwischen Region und weiter Welt, zwischen Vertrautem und Fremdem, zwischen kleinen Verhältnissen und exotischen Abenteuern, zwischen sozialer und künstlerisch-literarischer Erfahrung.“ Hier ein Beispiel für die ganz besondere Art von Walter Kaufmann, zu schreiben:
„Monique
Ich hörte die Eltern Städte wie Stuttgart nennen, München, Hamburg und Berlin, wo Monique schon aufgetreten sei, sah die Bilder eines Bühnenfotografen von einer zarten jungen Tänzerin mit hoher Stirn, dunklen Augen und straff zurückgekämmtem Haar, und als das Ballett, dem sie angehörte, ein Gastspiel in Duisburg gab, stand für mich fest, das würde ich erleben – trotz JUDEN UNERWÜNSCHT!, und am selben Abend noch löste ich eine Karte für hoch oben im vierten Rang.
Für Monique nahm ich gern das Risiko auf mich – ohnehin war ich mir als Zwölfjähriger des vollen Risikos nicht bewusst. Wirklich bewusst aber war ich mir jenes Gefühls aus fernen Kinderjahren, das seinen Ursprung in Moniques Zärtlichkeiten hatte. War ich der Cousine auch lange nicht begegnet, was im Elternhaus über sie gesagt wurde, nahm ich mit wachen Sinnen auf, und wusste natürlich, dass sie schon seit langem nicht mehr Gerson hieß, sondern von Langenfeldt, und ihre Heirat mit einem Adligen, eine heimliche, wie ich hörte, weckte romanhafte Vorstellungen in mir.
Jetzt, umgeben von Tschaikowskis melodischen Klängen, entrückt in andere Welten, vermochte ich in der Dunkelhaarigen im Corps de Ballet dort unten, in dem Schwarm anmutig über die Bühne gleitender Tänzerinnen, Monique nur zu vermuten – war sie es überhaupt, und wenn sie es war, wie würden wir zusammenfinden? Mich ernüchterte der Gedanke, dass ich es nicht einmal wagen durfte, mich in den Gängen zu zeigen, geschweige denn Monique nach der Vorstellung aufzusuchen.
Vor den Eltern verheimlichte ich den Theaterbesuch, gab vor, die Zeit bei einem Schulfreund verbracht zu haben, aber wissen wollte ich doch, wie es kam, dass Monique überall in Deutschland auftreten durfte, auch im Stadttheater von Duisburg, wo Juden selbst als Besucher unerwünscht waren. Die Erklärung, Monique verdanke ihren Sonderstatus dem Einfluss ihres Mannes, leuchtete mir zwar ein, gleichzeitig aber stieß ich mich daran, fühlte ich mich auch deshalb von ihr entfremdet, weil sie sich während des gesamten Gastspiels nicht einmal bei uns gemeldet hatte – warum bloß! Immer seltener dachte ich an sie, und als ich drei Jahre später nach England auswanderte, hatte ich sie so gut wie ganz aus dem Bewusstsein verdrängt. Als mir aber gänzlich unerwartet ihr Besuch im Internat angekündigt wurde, kam wieder das ursprüngliche Gefühl in mir auf, und ich sah dem Tag erwartungsvoll entgegen.
Sie kam an einem Sonntag, Tag der offenen Tür, und Angesicht zu Angesicht mit ihr überkamen mich völlig neue Empfindungen – sie war die Cousine nicht länger und ich nicht der kleine Cousin. Nahezu sechzehn inzwischen, sah ich sie anders, erschien sie mir auf gänzlich neue Weise schön. Noch immer trug sie ihr Haar streng zurückgekämmt, verrieten ihre Bewegungen und wie sie die Füße setzte die Tänzerin. Sie eilte auf mich zu, und das Schmiegsame, Weiche, ungeheuer Weibliche in ihrer Umarmung, der Duft ihres Haares, ihrer Haut betörten mich. Wie sie sich mir gab, fühlte ich mich über mein Alter hinausgetragen. Ich bemühte mich um Männlichkeit, war galant zu ihr, zuvorkommend, kannte und erkannte mich selbst kaum noch. Und nur für die kurze Spanne Zeit, als sie von meinen Eltern sprach, die sie kürzlich noch gesehen hatte und von denen sie mir Grüße brachte, ließ ich mich gehen.
Während wir durch den Schulpark und die anliegenden Wiesen schritten, sah ich mich als ihr Begleiter und hoffte, dass, wer immer uns zusammen bemerkte, es auch so sah. Als es sich ergab, dass ich ihr über einen Graben helfen musste, verwirrte und erregte mich die Berührung. Es dauerte, bis wieder ein normales Gespräch möglich wurde und ich sie fragen konnte, wie sie aus Deutschland geflohen war. Als ich erfuhr, es sei der Intervention ihres Mannes zu verdanken gewesen – „das immerhin tat er noch für mich“ und sie hinzufügte, dass er ihr Mann nicht mehr sei, er unter dem Druck seiner Familie die Trennung vollzogen und die Scheidung bewirkt hatte, drängte es mich spontan, ihr zur Seite zu stehen.
„Ich hab etwas gespart“, sagte ich. „Und hier im Internat brauche ich kein Geld.“
Sie sah mich liebevoll an. „Aber nein doch. Wo denkst du hin? Für mich ist gesorgt.“
„Tanzt du wieder?“
„Das nicht – noch nicht.“
„Wovon also lebst du?“
Nichts begehrte ich sehnlicher in dem Augenblick, als dass sie mich brauche, und mir war, wie wenn sich über mir der Himmel verdüstere, als sie einen Engländer ins Gespräch brachte, einen Choreografen, bei dem sie lebe und dessen Haushalt sie führe.
„Tatsächlich“, sagte ich schroff. „Du führst seinen Haushalt.“
Ihr Lächeln verriet mir, dass sie meine Bitterkeit nicht wahrgenommen hatte – oder nicht wahrnehmen wollte.
„Recht gut sogar“, sagte sie. „Denn weißt du, ich liebe ihn und hoffe ihn zu heiraten. Sollte das wahr werden, würdest du dann zur Hochzeit kommen – du wärest der einzige aus der Familie. Wir sind ja alle so verstreut.“
Ihre Bitte drängte meine Aufwallung von Gefühlen ins Absurde, gar Lächerliche, erstickte sie im Keim.
„Und wenn dieser Engländer erfährt, mit wem du verheiratet warst – einem Achim von Langenfeldt?“
„Das muss er nicht erfahren. Das weiß er.“
„Aber doch wohl nicht, dass der Mann ein Förderer der SS war – wenn ihn das erreicht …“
Ich hielt inne. Sie aber musste meine Worte wie eine Drohung empfunden haben, denn sie wandte sich brüsk ab, ging schweigend über die Wiesen und vor mir her durch den Park. Ich folgte ihr und verwünschte mich für meine Bemerkung.
„Er wird das nicht erfahren“, rief ich ihr nach. „Von mir nicht!“
Sie ging jetzt so schnell, dass ich Mühe hatte, mit ihr Schritt zu halten, und selbst am Tor, das zum Schulpark hinaus auf die Straße führte, drehte sie sich nicht nach mir um.
„Monique, so hör doch – lass mich wissen, wann die Hochzeit ist! Ich komme bestimmt.“
Sie zeigte nicht, dass sie mich gehört hatte. Ich sah sie ein Taxi abpassen, das gerade anfuhr, sie stieg ein, und das Taxi trug sie fort. Und von der Hochzeit erfuhr ich erst durch ein Foto in Town & Country-Monique in schlichtem Tweedkostüm, ein eng anliegendes Hütchen mit Feder auf dem Kopf, in der Linken das Bukett, die Rechte sanft auf dem Arm eines Mannes, der sich zu ihr herabbeugte.
Ich riss das Blatt mit dem Foto aus dem Heft, faltete es zusammen, um es in meinem Tagebuch zu verwahren.
Als ich es aber Wochen später dort nicht fand, ließ mich das kalt, spürte ich nichts mehr von jener Gefühlsaufwallung, die mich überkommen hatte. Monique war wieder die Cousine und ich noch keine sechzehn Jahre alt.“
Soweit dieser Walter-Kaufmann-Newsletter, wenn man so sagen darf, der auf jeden Fall ein würdiger Auftakt für den 2021-er Jahrgang der Newsletter aus dem Hause EDITION digital darstellt.
Verlag und Redaktion der wöchentlichen Newsletter bleibt jetzt gar nicht mehr viel zu tun, als viel Vergnügen beim Lesen und Nachdenken über das Jahrhundert sowie über das Leben, über seine Schönheiten und über seinen Sinn sowie einen guten Rutsch und ein glückliches und vor allem gesundes, ein aufregendes und erregendes, spannendes und erfolgreiches Neues Jahr 2021 zu wünschen (Endlich ist hier dieser über-lange Satz zu Ende. Mark Twain hätte sich wohl diebisch gefreut …) Apropos freuen: Freuen Sie sich schon auf die nächsten Newsletter des 2021-er Jahrgangs und auf die nächsten Sonderangebote und bis demnächst.
EDITION digital war vor 26 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.000 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()