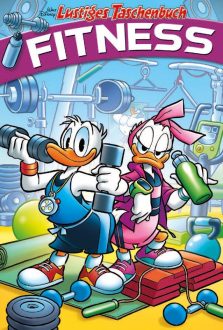Ein Glückstreffer in Ahrenshoop, 1124 Tage auf See sowie Depressionen und Soljanka
Eine abenteuerliche Reise zu den Gewürzinseln vor 500 Jahren ist der historische Hintergrund für den Roman „Magellans Page“ von Rudi Czerwenka.
Wie schon in der letzten Woche ist auch diesmal Matthias Biskupek mit zwei seiner Bücher in diesem Newsletter vertreten. Und auch diesmal sind es kritisch-satirische Blicke auf sein Land, die er in „Leben mit Jacke“ und „Biertafel mit Colaklops. Satirische Zutaten von Claudia bis Kanada“ präsentiert. Und trotz aller Kritik kann er seine Sympathie für dieses Land und seine Leute nicht verhehlen. Und auch seinen Humor nicht.
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Auch dieses Mal geht es um die Themen Zweiter Weltkrieg und antifaschistischer Widerstand, dargestellt an der spannenden Biographie eines Mannes, der sich klar entschieden hatte – für Frieden und Gerechtigkeit und für das Glück der Menschen. Und man lernt die Gedanken und das Handeln der ersten Generation der DDR-Führungselite besser zu verstehen und einzuordnen.
Erstmals 1959 veröffentlichte Hasso Grabner im Deutschen Militärverlag Berlin den Erlebnisbericht „Mit falschem Pass“. Dem E-Book liegt die Neuausgabe zugrunde, die 1965 unter dem veränderten Titel „Der Weg nach Hause. Erinnerungen aus dem 2. Weltkrieg und dem antifaschistischen Widerstandskampf“ erschienen war: Mit falschem Pass schlägt sich ein Mann durch die Welt. Von Berlin über Tallinn nach Moskau, über Prag, Wien, Paris nach Spanien, über Frankreich, Belgien nach Holland – und endlich zurück nach Berlin. Diesen Weg ging Ewald Munschke, später Generalmajor der NVA, in den Jahren 1933 bis 1945. Hier zur Einstimmung der Prolog zu diesem spannenden Erlebnisbericht:
„Ein Regiment setzte in der Nähe eines kleinen thüringischen Dorfes über einen Fluss. Panzer rollten die Böschung hinunter, Bugwellen schäumten auf, die Ketten wühlten durch den Grund, heulend stiegen die Ungetüme am jenseitigen Ufer wieder bergan.
Aus dem Dorf waren viele Neugierige gekommen, sie säumten das Wasser und sahen zu. In vielen Gesichtern standen Bedenken. Manch einer hatte diese Stahlkolosse noch in lebhafter Erinnerung – und nicht in guter.
Bei der Übung waren höhere Offiziere anwesend, die sich vom Ausbildungsstand der Truppe überzeugen wollten. Einer, der neben mir stand, kam mit einem Manne ins Gespräch. „Verstehen Sie etwas davon?“
Der Mann nickte und zeigte auf seinen Ärmel, der leer in der Tasche steckte. „Und ob“, sagte er. Es klang bitter. Bitter, wie Erinnerungen manchmal sein können.
„Waren Sie bei den Panzern?“, fragte der Offizier.
„Unfreiwillig, ja.“
„Ich verstehe“, sagte der Offizier, „Sie denken nicht mehr gern daran. Wo haben Sie denn den Arm verloren?“
„Russland“, antwortete der Mann.
Sie schwiegen. Ein neuer Panzer tauchte in schneller Fahrt ins Wasser, die Bugwelle stand vor dem Riesen, schon zog ihn der Fahrer geschickt auf das inzwischen zerfahrene Ufer.
Der Offizier nahm das Gespräch wieder auf. „Das sind nicht die gleichen Panzer.“
„Sie sind ähnlich.“
„Ja, so ist das. Panzer sehen sich ähnlich. Uniformen haben diesen oder jenen Schnitt, doch es sind Uniformen. Waffen sind Waffen.“ Der Mann nickte und sah den Offizier an, weil er jetzt nicht mehr wusste, wie der das meinte. Er unterstrich deshalb noch einmal, was jener gesagt hatte. „Waffen sind Waffen und Uniformen – Uniformen.“
„Sie haben recht, nur die Menschen darin sind andere. Auch der Zweck ist ein anderer. Das ist der Unterschied. Meinen Sie, dass diese Panzer auch einmal in fremde Länder einbrechen könnten wie der, in dem Sie gesessen haben?“ Der Mann zuckte mit den Schultern.
Es schien dem Offizier geraten, das Thema zu wechseln.
„Was sind Sie von Beruf?“
„Ich war Bauarbeiter“, antwortete der Mann und zeigte noch einmal auf seinen leeren Ärmel. „Jetzt bin ich Pförtner. Zu nichts anderem mehr zu gebrauchen.“
„Bauarbeiter!“ Der Offizier sah sich eine Weile im Gelände um. „Sehen Sie da drüben den General?“
Der Mann mit dem leeren Ärmel nickte.
„Munschke, heißt er, Ewald Munschke, Generalmajor der Nationalen Volksarmee, Beruf: Bauarbeiter. So steht es in seinen Akten, und so ist es. Ein Kollege von Ihnen, ein früherer, wenn Sie wollen, aber das ändert nichts daran. Würden Sie sein Leben kennen, wüssten Sie: Uniformen und Panzer können sich ähneln, aber die Menschen sind anders, ganz anders.“
Dem Offizier wurde etwas zugerufen. Er grüßte lächelnd und ging. Der Mann mit dem leeren Ärmel sah ihm nach, seine Stirn war vom Überlegen gefurcht.
Ich blickte zu dem General hinüber. Der Wunsch stieg in mir auf, mehr von diesem Manne zu erfahren.
Ein paar Wochen später saß ich ihm gegenüber. Er war gern bereit, mir die Geschichte seines Lebens zu schildern. Ich will versuchen, sie nachzuerzählen.“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderausgaben dieses Newsletters:
Erstmals 2008 veröffentlichte Wolfgang Schreyer im BS-Verlag Rostock Angelika Bruhn „Ahrenshooper Begegnungen. EIN HAUS AM MEER UND SEINE GÄSTE“: Stefan Heym, Brigitte Reimann, Dieter Wellershoff, aber auch Erich Loest, Walter Kaufmann, Reiner Kunze oder Ralph Giordano – all diese Autoren waren in den letzten 50 Jahren zu Gast bei Wolfgang Schreyer in Ahrenshoop. Die Begegnungen mit ihnen, die er in diesem Band erstmals schildert, geben einen unverstellten Einblick in das, was deutsche Schriftsteller in Ost und West in dieser Zeit bewegt hat und bis heute beschäftigt. Nicht zuletzt zeigt dieses kurzweilige Buch, was den Künstlerort Ahrenshoop vielleicht bis heute ausmacht – lebendiger Austausch über Genregrenzen hinweg. Aber wie war Schreyer überhaupt zu seinem Anwesen gekommen? Erhellendes dazu findet sich gleich am Anfang seines Buches:
„Das Kaperschiff
So absurd es auch klingt, ich verdanke mein Glück der amerikanischen Luftwaffe. Deren Männer hatten zwar im Januar 1945 das Fachwerkhaus meines Großvaters, in dem wir wohnten, und zwei Straßen weiter die Drogerie meiner Eltern gleich mit zerbombt. Der alliierte Sieg jedoch setzte den Fernflügen der US Air Force durchaus kein Ende. Schon im August 1946 verlor sie zwei schwere Maschinen über Jugoslawien. Und kurz vor dem Ausbruch des Koreakriegs, am 8. April 1950, schickte ihr Stab einen Fernaufklärer vom Typ „Privateer“ (zu deutsch „Kaperschiff“) quer über die Ostsee bis zur lettischen Küste der Sowjetunion. Die „Privateer“ sah aus wie der Typ Boeing B-29 „Superfortress“, aus dem die zwei Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki gefallen sind. An jenem Karfreitag 1950 nun starten vier sowjetische MiG-15, um den tieffliegenden Späher zur Landung zu zwingen. Als der sich wehrt, schießen sie ihn kurz vor Libau (Liepaja) ab.
Der erste spektakuläre Luftzwischenfall im Kalten Krieg ist da. Ihm folgt eine groß angelegte Suchaktion amerikanischer Seeaufklärer. Nur ein paar Schwimmwesten, Signalpatronen und Keksschachteln werden in der östlichen Ostsee noch entdeckt; mit zehn Mann ist das „Kaperschiff“ versunken. Doch dieser Totalverlust hilft der US-Luftfahrtindustrie auf, die seit dem Kriegsende rote Zahlen schreibt. Ihre Auftragsbücher füllen sich; der Börsenwert der fünf wichtigsten Rüstungsfirmen steigt schlagartig um ein Drittel.
Und den amerikanischen Außenminister Acheson inspiriert die Affäre zu einem „Wahrheitsfeldzug des State Department“. Auf Weisung von Präsident Truman geht er daran, der „Propaganda des kommunistischen Totalitarismus“ zu begegnen, sie nämlich, laut New York Times, „durch ehrliche Darlegung der Wahrheit über Freiheit und Demokratie zu überwinden.“ (Klingt bekannt? Freedom and democracy, es klang schon vor 60 Jahren so.)
Von nun an mehren sich solche Fälle; ein Jahrzehnt geht so ins Land. Ich vermerke jede Meldung; als ehemaliger Flaksoldat mit den Daten der Flugzeuge wie auch mit der Abfangtechnik damals ganz vertraut. Achesons „Wahrheitsfeldzug“, dem schließe ich mich als Chronist jetzt an. Das bleibt ohne Peinlichkeit, denn seltsam, es ist immer nur die US Air Force, die da fremde Grenzen überfliegt. Die Luftwaffe der zweiten Weltmacht, technisch gar nicht schlechter, hält sich klar zurück. Kein einziger Fall von Späh- oder gar Angriffslust wird ihr in all der Zeit angelastet.
Unterstützt von der Neuen Berliner Illustrierten, auch mit Fotos aus ihrem Bildarchiv, schreibe ich eine Serie – die Art von halbdokumentarischer Darstellung, deren Chancen und Grenzen gerade mein Kriegsbuch („Unternehmen Thunderstorm“) zu erkunden sucht. Im Hinblick auf den bald schon legendären Libau-Zwischenfall entsteht, nach dem Hörspiel „Schüsse über der Ostsee“, schließlich mein zweiter Roman zur Zeitgeschichte: „Der Traum des Hauptmann Loy“.
Für das Sachbuch, die Chronik der Affären, fällt mir der Titel „Augen am Himmel“ ein, als der Ablauf plötzlich eskaliert. Am 1. Mai 1960 wird erstmals ein US-Höhenspion des Typs U-2 von einer Sowjetrakete erwischt, nahe dem Ural bei der Stadt Swerdlowsk. Antriebslos taumelt die U-2 im Gleitflug abwärts, unversehrt schwebt der Pilot am Fallschirm in Gefangenschaft. Ausflüchte Washingtons fegt der Kreml weg und legt Sachbeweise vor, gekrönt vom Geständnis des Piloten Powers. Da erklärt das Weiße Haus, der US-Präsident selbst habe seit Beginn seiner Amtszeit (1952) solche Geheimflüge befohlen, als „unerlässlich für die Sicherheit des Westens“. Nikita Chruschtschow ist wütend. Sein Gipfeltreffen mit Eisenhower, anberaumt in Paris zum 19. Mai 1960 – damit ist es geplatzt.
Zur selben Zeit sucht mich Professor Dr. Kurt Maetzig mit zwei Begleitern in Magdeburg auf. Ich weiß nicht mehr viel von dieser ersten Begegnung. Mir ist, als habe er gescherzt: „Früher scheiterten Flugzeuge an Gipfeln, heute ist es umgekehrt.“ Spottlust und Liebenswürdigkeit prägen seinen Stil. Im Breitwandformat „Totalvision“ will er meinen Roman „Der Traum des Hauptmann Loy“ verfilmen – zwar noch schwarz-weiß, doch mit Stars wie Günter Simon, Horst Drinda und Fred Düren; selbst Nebenrollen sind noch mit Christine Laszar, Jana Brejchowa, Ekkehard Schall und Ulrich Thein besetzt.
Ich bin verblüfft, schwer beeindruckt. Kurt Maetzig, DEFA-Mann der ersten Stunde, hat deren Wochenschau begründet. Ihn umgibt die Aura von Perfektion und Kompetenz. Filmprojekte, das weiß jeder Autor, werden oft in den Gremien zerredet und sterben, noch bevor die erste Klappe fällt. Aber nicht bei diesem Mann; die Studioleitung hört auf ihn. Etliche seiner Werke – wie „Ehe im Schatten“ – zählen zum Besten des ostdeutschen Films, zu einer Zeit, da der westdeutsche künstlerisch arg darniederliegt. Zumal sein „Der Rat der Götter“ hat sich mir eingeprägt. Bringt er für mich doch das auf den Punkt, was der Volksmund seit langem in Sätze fasst wie: „Der Krieg geht für die Reichen“ und „Geld regiert die Welt“. Schlichte Weisheit, hinreißend ins Bild gesetzt hier.
Da begegnen sich zwei Leute in dem Wunsch, zu zeigen, was derzeit passiert, wie es zugeht auf der Welt. Der Regisseur, 49, Spitzenmann des Fachs, steht im Zenit seines Schaffens. Und kaum ist „Der Traum …“ abgedreht, da schwebt ihm etwas vor, das uns beide im Juni 1961 nach Cuba führt. Nie gab es wieder einen so sprachkundigen wie kameradschaftlichen Reisegefährten für mich wie ihn. Längst haben wir uns angefreundet dort in der Ferne, auf Stoffsuche für einen Film, der dann „Preludio 11“ heißen wird, da bietet er mir eher beiläufig sein Ahrenshooper Sommerhaus zum Kauf an. Erst sechs Jahre steht es, wird von ihm wenig genutzt, und der Preis ist mehr als fair: zwei Drittel der Baukosten … Heutzutage würde das kein Bauherr oder Immobilienmakler fassen.
Das Grundstück selbst ist wie geschenkt zu den sagenhaft niedrigen Bodenpreisen von 1936, die in der DDR weiterhin gelten. In dankbarer Erinnerung an jenen Streifzug durch das ferne Cuba nenne ich das Haus Cucana – ein spanischer Ausdruck für „leichtes Geld“ oder „Glückstreffer“, der in unserem Film als Codewort fällt.
Meine Familie, damals erst dreiköpfig, zieht Ende 1962 fröhlich ein. Im Oberstock, unterm Rohrdach, wohnt unentgeltlich, von dem Besitzerwechsel ganz unberührt, ein Rentnerpaar: Umsiedler aus dem Sudetenland. (Falls dies denn das rechte Wort noch ist; ein Gast vom Rhein erklärt mir später, dass „Umsiedler“ ein Euphemismus sei, ein Hüll- oder Tarnwort der DDR für „Flüchtlinge“ oder „Vertriebene“, wie es korrekt im Westen heißt.)
Der alte Josef Walter, er spielt noch die Orgel in der schilfgedeckten Schifferkirche Ahrenshoops, überträgt etwas von dem Respekt, den ihm Titel und Rang des Professors einflößten, zu meiner Verwunderung auf mich. Seine Frau, die resolute Maria, wird ihn um sieben Jahre überleben. Die Eheleute hüten das Haus, halten den Zaun instand und stellen uns Sträuße aus Ilex und Feldblumen hin, wenn wir im Frühsommer aus Magdeburg kommen.“
Erstmals 1959 veröffentliche Rudi Czerwenka, damals noch unter dem Pseudonym Rudolf Wenk, im Leipziger Prisma-Verlag Zenner und Gürchott seinen Roman „Magellans Page“: Am 20.September 1519 verließen fünf Karavellen mit 265 Mann an Bord unter dem Kommando des Portugiesen Fernando de Magellan den südspanischen Hafen Sanlucar. Ihr Auftrag war, auf dem Westkurs über den Atlantik und eine angeblich schiffbare Passage von Südamerika (die spätere Magellan-Straße) und den Pazifik zu den Molukken, den „Gewürzinseln“ vorzudringen und nach deren Annektierung über den Indischen Ozean, das „Kap der Stürme“ entlang der Westküste Afrikas heimzukehren. Unterwegs hatte man jedoch ungewohnte Stürme und Flauten, Hitze und Kälte, Hunger und Durst, bisher unbekannte Krankheiten, Meutereien, Havarien und kriegerische Auseinandersetzungen zu bewältigen. Als der Rest der Flotte schließlich auf dem kleinsten der Schiffe, der „Victoria“, nach 1124 Tagen Seereise am 7. September 1522 wieder im Heimathafen anlegte, befanden sich nur noch 18 Mann an Bord. Auch Admiral Fernando de Magellan hatte nicht überlebt, im Gegensatz zu seinem Pagen Vasco Gomez Gallego. Der rettete auch das von seinem Freund Antonio Pigafetta sorgfältig geführte Logbuch für die Nachwelt. Dieses in Teilen erhalten gebliebene Bordbuch und andere Dokumente über die erste Weltumseglung lieferten die Grundlage für das überaus spannend geschriebene Buch. Gleich am Anfang lernen wir die beiden kennen – Magellan und seinen künftigen Pagen und sie sich übrigens auch:
„EIN FREMDER TAUCHT AUF
Huelva ist eine kleine Stadt an der spanischen Südküste. Etwa fünfzig Kilometer weiter westlich trennt die Grenze das hügelige Gelände zwischen Spanien und Portugal. Früher war Huelva ein Dorf, eine Ansiedlung von Fischern und Bauern. Erst die Mauren gaben Huelva ein städtisches Gepräge. Weiße Steinbauten mit schlanken Säulen und Türmchen zeugen an verschiedenen Stellen der Stadt von der jahrhundertelangen Herrschaft der Mohammedaner.
In Huelva ließ sich das Leben Zeit. Der Seewind brachte wenig Kühlung in die sommerliche Hitze. Wenige Menschen zeigten sich auf den staubigen Straßen. Kinder spielten vor den Häusern und wirbelten beim Laufen und Jagen Staubwolken auf. Aus einer Schmiede klang der Schlag der Hämmer. Irgendwo sang eine Frauenstimme ein schwermütiges Lied.
Die Umgebung der Stadt hatte sich in Jahrhunderten kaum verändert. Schlechte Straßen schlängelten sich durch das Land, das häufig ungenutzt und unbebaut liegenblieb. In den sanften Ebenen leuchteten Weizenfelder und betupften das schmutzige Grün der Landschaft mit gelben Flecken. Olivenpflanzungen belebten einige Berghänge. Schafherden krochen über die Bodenwellen und suchten sich kümmerliche Nahrung. Über allem glühte eine unbarmherzige Sonne. Es war das Jahr 1517.
Ein Fuhrwerk quälte sich auf dem Landweg voran, der von Westen her die Stadt erreichte. Die vier Pferde schnauften. Die Fahrgäste unter dem geschlossenen Verdeck des klobigen Reisewagens schwitzten. Straßenstaub drang durch die feinsten Ritzen ins Wageninnere. Eine neunstündige Fahrt hatte die Reisenden müde und schläfrig gemacht. Auch der behäbige Fuhrmann auf dem Bock hielt die Augen geschlossen. Sein Kopf wackelte hin und her. Der Kutscher verließ sich auf seine Pferde. Sie kannten den Weg. Die Fahrt zwischen der Grenze und Huelva war ein gutes Geschäft. Meist waren es verdächtige, finstere Gestalten, die auf den harten Wagensitzen saßen, politische Flüchtlinge, Schmuggler oder Verbrecher. Der Fuhrmann fragte nicht viel, wenn sie nur bezahlten.
Der Bürger, der an der Wagentür Platz gefunden hatte, schien nicht zu seinem Vergnügen zu reisen. Er war ein Mann in mittleren Jahren. Unter seinem dunklen Bart verbarg sich ein scharf geschnittenes Gesicht mit nachtschwarzen Augen. Der Mann schien die Hitze nicht zu spüren. Sein enges Wams blieb am Halse fest geschlossen. Untadelig gerade saß der steife Hut auf dem Kopf. Auf den schwarzen, eng anliegenden Beinkleidern lag Staub in einer dünnen, grauen Schicht.
Der Reisende kümmerte sich nicht um die anderen Fahrgäste. Sein Blick ging starr geradeaus und streifte nur zeitweise einmal über die Landschaft am Wegrand.
Die beiden Bauernmädchen auf den Plätzen gegenüber tauschten leise ihre Meinung über den sonderbaren Fremdling aus.
Hinter einer kleinen Steigung lag jetzt in der Ebene das Ziel der Reise, Huelva. Die Pferde warfen die Köpfe, schnoben ein paarmal heftig und stampften dann mit frischer Kraft weiter.
In den Straßen der Stadt begann das Fahrzeug zu rumpeln und rüttelte die Insassen wach. Scharen von Kindern liefen neben dem Wagen her. Fremde waren immer eine willkommene Abwechslung in der Öde des Alltags. Der Fuhrmann knallte mit der Peitsche, um die Kinder zu verjagen und seinen Pferden den Weg freizumachen. Noch ging es ein Stück Weges bergan. Dann hielten die Tiere selbständig vor der Herberge. Sie schüttelten sich im Geschirr und blickten mit großen Augen zu dem maurischen Brunnen auf dem Platz, der frisches Wasser sprudelte. Der Fuhrmann kletterte von seinem Hochsitz und klappte die Treppe an der Wagentür herunter. Ein dicker Bürger stieg prustend aus dem Wagen, klopfte den gröbsten Staub von seiner Kleidung und half seiner Frau beim Versuch, dem weiten, langen Kleide zum Trotz die Treppe zu finden. Die Ankömmlinge wurden erwartet. Verwandte oder Bekannte umarmten und begrüßten sie. Dann zog die Gesellschaft mit ihrem Besuch und dem Gepäck lärmend davon.
Der dunkelgekleidete Fremde stand auf der Straße und sah sich um. Er musste den Bauerndirnen weichen, die große Körbe aus dem Wagen zogen und dazu viel Platz brauchten. Misstrauisch stand der Gastwirt auf der Treppe seiner Herberge und schaute nach Gästen aus. Er blies seine Backen geringschätzig auf. Er kannte die Menschen. Mit dem Mann dort am Wagen, so vornehm er aussah, konnte man seine Schwierigkeiten haben. Die „Heilige Hermandad“, die Polizei, war überall. Der Wirt verschwand im Haus und lugte durchs Fenster.
Der Fuhrmann lud das Gepäck des Fremden ab, ein rundes Paket und zwei große Ledertaschen, denen man ihr Alter und ihren weiten Lebensweg ansah. Sofort stürzten einige Knaben auf die Gepäckstücke los. Die kleinen Gelegenheitsarbeiter kämpften mit Schreien und Püffen um den Verdienst, der zu erwarten war. Ein etwa Fünfzehnjähriger hielt das Paket bereits fest zwischen den Beinen. Mit den Taschen schlug er um sich und verscheuchte die schimpfenden Nebenbuhler. Der kleine Sieger stellte die Taschen ab und wischte den Schweiß von der Stirn.
„Darf ich Ihnen das Gepäck ins Haus tragen?“, fragte er in dem singenden Dialekt Andalusiens.
„Ich brauche dich nicht“, hieß die kurze Antwort des Mannes. Aber weil der Bursche gar so enttäuscht war und ihm die Tränen schon hinter den Lidern hingen, fuhr er versöhnlich fort: „Ich habe hier kein Haus und fahre heute Abend weiter nach Sevilla“. Der Knabe wandte sich langsam weg. Sein struppiger Schopf sank nach unten. Der Mann empfand Mitleid. Das Kerlchen hatte so tapfer um die paar Münzen gekämpft. Es war arm, das sah jeder. Die zerlumpte Hose fiel bald auseinander, und durch das Hemd lugte an mehreren Stellen der braune Oberkörper.
„Bring mein Gepäck ins Wirtshaus!“, befahl der Fremde. „Dann kannst du mich zum Hafen führen. Ich habe noch Zeit.“
Schnell hatte der Junge das Gepäck untergebracht. Mit leichter Verbeugung nahm er die Entlohnung entgegen und steuerte dem Hafen zu. Der Mann folgte mit einem Schmunzeln um die Lippen. Der kleine Führer ließ den Fremden neben sich und beobachtete ihn. Schön war der dunkle Mann wahrhaftig nicht, auch in keiner Weise freundlich. Aber böse, nein, böse sah er auch nicht aus. Er war klein, nur eine Fingerspanne größer als der Junge, und mochte fünfunddreißig oder vierzig Jahre alt sein. Ein Bein schleifte er beim Gehen leicht nach, dadurch bekam der Körper eine seitlich gewandte, schiefe Haltung. Ein dichter, lockiger Vollbart verdeckte die untere Hälfte des gebräunten Gesichtes. Nur die feuchte, breite Unterlippe ragte aus dem schwarzen Haargewirr heraus. Die Augen waren groß, dunkel und von bezwingendem Glanz. Starke Brauen beschrieben darüber einen hochgewölbten Bogen. Die fleischige Nase saß zwischen den beiden scharfen Falten, die sich zu den Mundwinkeln hin im Bart verloren. Über die linke Wange lief eine breite Narbe. „Ein alltäglicher Mann“, dachte der Knabe. „Woher mochte er kommen, wer mochte er sein? Sicher ein Flüchtling, wie sie zu Dutzenden nach Huelva kamen. Er sollte lieber hierbleiben und nicht nach Sevilla reisen, in die Residenz. Hier konnte man leichter unterschlüpfen.“´
Erstmals 1985 erschien im Eulenspiegel Verlag Berlin der Geschichten-Band „Leben mit Jacke“ von Matthias Biskupek: In 17 Geschichten schildert der Autor humorvoll und überspitzt den Alltag in der DDR mit seinen Menschen und Problemen. Helmut betreibt einen Kult um seine Lederjacke, die es in der DDR nicht zu kaufen gibt. Alfred rächt sich an seinen Kollegen, die seinen Garten mit seltsamen Pflanzen bei einer Grillparty verwüsten, mit von ihm gezüchteten schnellwachsenden Pflanzen. Autor und Verlagsmitarbeiter schrumpfen fast auf Däumlingsgröße. Hümpe bombardiert die Behörden mit Eingaben. Und hier die Titelgeschichte:
„Leben mit Jacke
Als Helmut sechsundzwanzig Jahre alt geworden war, heiratete er eine Lederjacke.
Sie war schwarz und gut geschnitten. Wenn er mit ihr durch das Städtchen ging, fiel ein Glanz von ihr auf ihn.
Natürlich wusste man im Ort, dass er nicht auf gewöhnliche Weise an sie gekommen war. Es war bekannt, was in den lokalen Textilläden zu haben war. Eine solche Lederjacke wäre sofort aufgefallen. Und vermutlich wäre Helmut dann niemals gerade an diese Jacke geraten.
Er hatte sie per Annonce kennengelernt. Sie war als neuw. ungetr. angezeigt worden. Die Adresse war eine Telefonnummer und eine andere Stadt. Helmut hatte sich sofort zur Staatsbank und anschließend auf die Reichsbahn begeben.
Das erste telefonische Vorsprechen blieb ergebnislos. Eine männliche Stimme hatte ihm mit brutaler Offenheit mitgeteilt, dass nichts mehr zu machen sei.
Schließlich war es ihm doch gelungen, einen Termin zu erhalten. Er musste dafür eine ganze Reihe möglicher Annehmlichkeiten aufzählen.
Mit ihm waren noch zwei weitere Herren da. Er musterte die Konkurrenten misstrauisch. Dann wurde die Jacke hereingebracht. Von diesem Augenblick an wusste Helmut: Die muss es sein.
Sie sah wirklich völlig ungetragen aus. Das Leder glänzte sehr weich. Nichts Hartes, Steifes war an ihr. Keinerlei Falten, auch dort nicht, wo durch die Armbeuge unweigerlich Falten entstünden bei normalem Gebrauch. Die Knöpfe saßen straff; ihr Kragen war schmal und klein. Der Schnitt ihrer Seitentaschen zweifellos modisch, aber nicht von jener aufdringlichen Eleganz, die sie in wenigen Jahren würde veralten lassen.
Helmut war froh, dass sie nicht dabei war, als man sich, wie es beschönigend heißt, gütlich einigte. Man hatte die Jacke wieder ins Nebenzimmer gebracht. Die drei Herren hatten wie Kampfhähne ihre Trümpfe ins Feld geführt. Knisternde Scheine, laute Zusatzangebote.
Seltsam, dass in unserer aufgeklärten Zeit so etwas noch möglich war. Schließlich hatte Helmut mitgetan, und endlich war ihm die Jacke zugesprochen worden.
Ihm ging es nur um die Jacke. Wenn er sie erst trug, würde er das beschämende Spiel, an dem er sich beteiligt hatte, für immer vergessen können.
Die anschließenden Formalitäten waren rasch erledigt. Er musste etwas unterschreiben, was er niemals hätte mit gutem Gewissen unterschreiben dürfen. Doch es war so üblich.
Helmut widerstand der Versuchung, sofort die Jacke auf seinen Körper zu ziehen. Er musste hier Form wahren und ließ sie sich einpacken. Während der Bahnfahrt lächelte er versonnen aus dem Fenster und schob ab und zu das Packpapier, in dem sie leicht an seiner Seite ruhte, etwas auseinander.
Ihr tiefes Schwarz schimmerte ihm entgegen.
Später kam es Helmut seltsam vor, dass ihm nie der Verdacht gekommen war, sie könne vielleicht doch bereits getragen worden sein.
Was hieß denn neuwertig? Hieß das, dass sie nicht völlig neu war? Nur neuwertig?
Hatte schon einer sie besessen, entgegen der ausdrücklichen Zusicherung? War mit ihr durch eine fremde Stadt geschlendert, hatte sich anstarren, beneiden lassen, wie er jetzt?
Sah man einer Jacke an, ob sie ungetragen war beziehungsweise ob einer wirklich ihr allererster Träger war?
Hauptsache, dachte er, man dachte, er sei wirklich ihr erster Besitzer. Dann würde erst recht Neid aufkommen. Er, er allein, mit diesem exquisiten Stück.
Als ihn wiederholt solche Gedanken heimsuchten, schämte sich Helmut ob seiner Vorbehalte. Was bedeutete es denn, wenn eine Jacke bereits für kurze Zeit über einen anderen Körper gestreift worden war? Verlor sie damit irgendetwas von ihrer Neuwertigkeit? Von ihrem Glanz? Satt, schwarz.
War es nicht vielmehr so, dass sie sich mit jedem Tragen mehr und mehr seinem, nur seinem Körper anpasste? Harmonierten sie nicht zusammen? Besaß er sie nicht allein? Jede Falte in ihrer Armbeuge hatte er verursacht. Jedes leise Knacken in ihren Nähten rührte ganz allein von seinem Gebrauch.
Doch nutzen in solchen Fällen intellektuelle Beruhigungsversuche?
Immerhin ertappte sich Helmut später einmal dabei, dass er ihr Futter aufmerksam betrachtete. Sie lag etwas nachlässig über der Stuhllehne. Im grellen Licht der Frühlingssonne waren die feinen Stiche zu erkennen, mit denen der seidige, glänzende Futterstoff an das Leder genäht worden war. Er versuchte zu erkennen, ob dies Futter bereits einen andern gewärmt hatte. Ob vielleicht doch der Schweiß eines anderen Spuren an ihr hinterlassen hatte?
An diesem Tag war es auch, da er die ersten abgeschabten Stellen an ihr zu erkennen glaubte.
Solche Bedenken suchten Helmut immer häufiger heim. Dabei wusste er noch genau, wie er sie zum ersten Mal anprobiert hatte. Damals, vor den zwei Herren, mit denen er um sie gebuhlt hatte, wäre es ihm unwürdig vorgekommen. Er vertraute auf die Größenangabe.
Er hatte gewusst: Eine Lederjacke schmiegt sich an durchs Tragen, sie kann mitwachsen. Das hatte er gehofft: mit der Jacke verwachsen werden.
Damals, zu Hause, vor dem Spiegel; da zog er sie an. Langsam, ganz langsam. Etwas ungewohnt und fremd war ihr Leder auf seiner Haut.
Doch zugleich war ihm, als hätte er sie schon immer getragen.
Wenn sich später begehrliche Blicke auf sie richteten, dehnte sich sein Brustkorb. Die Knöpfe, die er immer wieder in anderer Verschlussstellung nutzte – mal einen, mal zwei, mal alle drei –, spürte er dann auf seinen Rippen. Er fühlte, die Jacke war da.
Glück: Das war der Druck dreier Knöpfe.
Bald ging er mit ihr in seine Stammkneipe. Er wusste, man bewunderte sie insgeheim. Auch wenn gutmütig gelästert wurde.
Es passierte schon mal, dass einer seiner Stammtischgenossen das Leder mit den Fingern befühlte. Helmut ließ das nur zu, wenn er schon viel getrunken hatte. Meistens klappste er dem betreffenden Kollegen auf die Finger. Bei der Lederjacke hörte sein Spaß auf. Anfangs.
Wenn er sie zu Haus über den Bügel streifte, zärtlich, und sie achtsam an der Flurgarderobe befestigte, roch er den Kneipendunst, den sie den ganzen Abend aufgesaugt hatte. Auch das machte ihn misstrauisch. Doch er hatte sie ja den ganzen Abend an sich gehabt.
Kneipenrauch: Das war ein Fremdling. Er hing an ihr, der Rauch, wie er selbst.
Als es Sommer und wärmer geworden war, ließ er sie öfter zu Hause. Schließlich, sagte er sich, man muss mal was anderes tragen. Die Freunde lachen ja schon über mich.
Als er die Jacke das erste Mal liegenließ, machte er sich Gewissensbisse. Er war bei Freunden zu einer Party gewesen. Man hatte ausgelassen getanzt, schließlich Fasching gespielt. Jeder verkleidete sich möglichst originell mit den vorhandenen Sachen. Dabei musste seine Jacke irgendwo abgeblieben sein.
Helmut war in einem fremden Regenumhang heimgeschwankt. Am nächsten Morgen ekelte es ihn vor dessen kalter, chemischer Glätte. Dabei glaubte, nein wusste er, dass er den Umhang extra erbeten hatte. Es goss mächtig in dieser Nacht. Helmut hatte gegrölt, seine Lederjacke sei ihm zu fein für diese gewöhnliche, proletarische Nässe. Er brauche etwas Rustikales, das den Regen von ihm abhalte.
Nun schauderte ihn vor dem farblosen Stück, das farblos und fischig in seinem Zimmer herumlag.
Helmut klingelte verkatert an der Wohnungstür seines Freundes. Es dauerte lange, bevor geöffnet wurde. Helmut wies mit beschämter Geste auf den Regenumhang, fragte nach seiner Lederjacke.
Der Freund grinste breit und verschwörerisch, bat Helmut herein. Auf dem Sofa lag seine Lederjacke. Achtlos. Ein Ärmel war roh umgewendet. Im Zimmer sah es wüst aus.
Helmut hängte seine Lederjacke über die Schulter und verschwand, ohne den Kaffee zu trinken, der ihm angeboten wurde.
Von diesem Tage an benutzte Helmut die Jacke auch zum Autoputzen. Er sagte sich, dass eine Lederjacke schließlich ein besonders praktisches Kleidungsstück sei. Warum sollte er es unnatürlich schonen? –
Er hatte sie lange getragen; abgeschabte Stellen wurden deutlich sichtbar. Ihr Glanz stumpfte ab. Zwar hatte er früher streng darauf geachtet, dass sie häufig mit Lederspray eingesprüht wurde. Doch das war lange vorbei.
Abgewetzt, grau, speckig, schimmerte sie an vielen Stellen durch das immer noch tiefe Schwarz.
Längst hatte Helmut es sich auch abgewöhnt, die Knöpfe über seinem Bauch zu schließen. Er war fülliger geworden. Die Jacke hatte mit ihm nicht Schritt halten können. Wer weiß, ob die Knöpfe das noch aushielten.
Er hatte keine Lust, mit abgerissenen Knöpfen herumzulaufen. Es musste nicht jeder sehen, dass die Fäden morsch geworden waren und dass er einfach keine Lust hatte, die Knöpfe sorgfältig nachzunähen.
Wenn er in seine Stammkneipe ging, nahm er die Jacke immer noch mit. Dort eingetroffen, hängte er sie gleich über den Stuhl. Da blieb sie, bis er bierschwer aufstand. Manchmal hatte er die Jacke nur noch aus alter Gewohnheit über dem Arm.
Schon oft hatte er sie liegengelassen. In der Straßenbahn, auf dem Wohnungsamt, selbst beim Fußball. Doch seltsam, immer wieder war sie ihm nachgetragen worden. Oder er hatte sie anderweitig, durch Zufall, wieder in die Hände bekommen.
Sie verstaubte mehrere Wochen auf dem Fundbüro. Weil er zufällig dort vorbeikam, fragte er nach. Sie war noch da, und das wunderte ihn nicht einmal. Er nahm dies und sie als Selbstverständlichkeit.
Eines Abends saß Helmut wie immer in seiner Stammkneipe. Ein junger Spund setzte sich zu ihnen. Sie redeten über dies und das.
Der junge Spund fragte leichthin, wem die Lederjacke gehöre, die da überm Stuhl.
Helmut brummte, er könne sie haben, das alte Ding, wenn er eine Lokalrunde ausgäbe. Sie tränken Korn.
Der junge Spund, hochgewachsen und gut gebaut, hängte die Jacke über seine Schultern, ging zum Kellner, bestellte die verlangte Runde und verließ die Kneipe schnell. Helmut starrte ihm nach.
Die Jacke schwang sehr leicht um den athletischen Körper des jungen Spundes.
D’Artagnan, dachte Helmut versonnen. Seltsam, wie so ein schäbiges Ding wirken kann. Die Eingangstür schwang wieder zu.
Als Helmut auf die Straße trat, fröstelte ihn.“
Erstmals 1995 veröffentlichte Matthias Biskupek Eulenspiegel in der Das Neue Berlin Verlagsgesellschaft mbH „Biertafel mit Colaklops. Satirische Zutaten von Claudia bis Kanada“: Der Autor ist ein Meister der Satire. Teilweise ins Sächsische verfallend oder das Englische eindeutschend, blödelt er über das Befinden der Ostdeutschen kurz nach der Wende. Eingeschlossen sind erste Reisen in vorher verbotene Länder, das Treffen mit der Westverwandtschaft und viele, viele Wortspielereien wie der Colaklops. Hier eine Anleitung zum richtigen und erfolgreichen Leben:
„Selbstsicherheit, lightgemaked
Die psychischen Krankheiten kommen von falscher Ernährung. Persönliches Unglück beruht auf dem Irrglauben, es gäbe feststehende Wahrheiten. Mangelnder Erfolg ist stockendem Sprechvermögen geschuldet.
Lieber Epochenteilnehmer, Sie wollen gesund, glücklich und erfolgreich werden, sein und bleiben? Lassen Sie sich im Folgenden einfach ein wenig von meinen Gedanken verwöhnen. Sie sind in keiner Weise dazu verpflichtet, sie mir abzunehmen. Doch ich darf Ihnen bei praktischer Anwendung gleichbleibenden sowie durchschlagenden Erfolg in Aussicht stellen. Mit Gedanken-zurück-Garantie!
Zunächst Beispiele für Sie, aus denen Sie lernen können: In beredter Runde wirft jemand die Frage nach der Amtssprache im Königreich Lesotho auf. Einer der Anwesenden sagt sofort: Afrikaans. Gläubiges Schweigen. Nur ein Zögerling wirft unsicher ein, er glaube aber, das sei vielleicht eher so was wie Englisch oder Kisuaheli. Der Sofortsager weist ihn zurecht: Das seien Umgangs- und Schriftsprachen, gemeinhin auch Staatsmundarten geheißen, aber die Amtssprache (aemteriisk sproaak) heiße seit einem Erlass vom Juli 1953 Afrikaans – übrigens vom damaligen südafrikanischen Generalgouverneur für die Nordost-Innergebiete, Ronald Houtemaker, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion (juristischer Fachbegriff: Night-nouvelle-Conclusion) durchgesetzt.
Der Einwerfer muss passen; der Sofortsager aber scheint für die Umstehenden zwei Zentimeter über dem platten Boden zu schweben.
Ähnliches können Sie bei Einwohnerzahlen erleben. Es geht z. B. um Southampton. Die zwischen achtzigtausend und einer halben Million geäußerten Zahlen klärt leis lächelnd der Experte: einhundertsiebenundvierzigtausend. Denn bekanntlich wird nach traditionellem englischem Recht einerseits nur der Hausbesitzer, andererseits aber werden alle ihm verwandten Personen gezählt, wobei nicht verwandte Bewohner nach den British House Acts ebenfalls dem Zahlenspiegel einverleibt werden dürfen, sofern sie nicht zugleich Halter frei laufender Tiere seien. Man kenne doch, schmunzelt der Experte, die spleenigen und traditionsbewussten Inselbewohner.
Auf vergleichbare Weise können Experten klarmachen, dass die Kupferstecher-Innung sich in der Defloration der Töchter einer angesehenen Augsburger Familie, den Kupfers, gründe; die Pariser Metro ihren Namen aus der Pünktlichkeit herleite, da ärmere französischen Schichten die Zugfolge als Metronomangabe nutzten und Potemkin ein von Stalin gegründetes Musterdorf war.
Nach dieser Ihrer Lernphase sollten Sie zum eigenmündigen Beeindrucken der Mitmenschen übergehen. Versehen Sie schnell alle Fragen mit spiegelglatten Antworten; Zögern verrät Unsicherheit. Angaben dürfen niemals ungefähr, sondern müssen stets absolut sein.
Sagen Sie Folgendes den zu Beeindruckenden auf den Kopf zu: Die Jungen Pioniere waren eine militärische Knabenorganisation, die vor allem Brücken bauen musste; bei absoluter Unterwerfung erhielten die Mitglieder den „Goldenen Ponton“. In selbstbewusster Bescheidung setzen Sie hinzu: Ich habe das damals abgelehnt und musste deshalb zwangsweise das verpönte Brustschwimmen lernen.
Erläutern Sie, dass der Auspuff des „Trabant“ so konstruiert war, dass eine gewisse Schadstoffmenge ins Wageninnere gelangte und den Fahrer zur Rammdösigkeit brachte, so dass er stets feige unter Tempo Einhundert bleiben musste. Setzen Sie nachdrücklich hinzu: Ich fuhr mutig bei geöffnetem Fenster einhundertunddrei und wurden dafür von schnüffelnden VoPopels an die Flensburger Stasizentrale gemeldet.
Verkünden Sie Ihren Bewunderern, dass ein großer Teil der Deutschen Mark derzeit in einer Frankfurter Hochdeponie lagert, um im Notfall europaweit aus Gulaschkanonen an die Bevölkerung verabfolgt zu werden.
Und glauben Sie sich vor allem selbst, wenn Sie unwiderruflich feststellen: Zweiundfünfzig Prozent aller Wähler sind überhaupt nicht zeugungsberechtigt. Eine neue Autobahn ist wie ein neues Leben. In Bulgarien wurde die Blutrache erst ab 1956 erlaubt. Der SPIEGEL schreibt Wahrheit wie gedruckt. Weiße Blutkörperchen ermöglichen AIDS. Willy Brandt war aber ja nun wirklich völlig erwiesenermaßen bei der Stasi. Soljanka fördert Depressionen. Katholiken sind glücklicher als weiße Versuchskaninchen. Deutsche Männer haben die Ausflugsgaststätte erfunden. Nur wer laut spricht, zeigt die lautere Selbstsicherheit. Gott ist christlich und glaubt deshalb an die CSU.“
Damit haben Sie eine der besten Anleitungen für ein besseres, erfolgreiches und selbstbewusstes Leben, die Sie sich denken können. Und Sie wissen jetzt auch, wen Sie bei der nächsten Bundestagswahl wählen und was Sie am besten nicht essen sollten. Oder haben Sie schon mal gehört, dass es in Bayern Soljanka gibt? Daher sollen dort auch Depressionen so gut wie unbekannt sein. Kapiert?
Aber auch die anderen Sonderangebote dieses Newsletters lohnen das Anschauen, Auswählen und Bestellen – egal, ob es nun nach Ahrenshoop, um die Welt oder in die frühe oder spätere DDR geht. Viel Vergnügen beim Lesen, viel Vorfreude auf den baldigen Sommer mit seinen (hoffentlich) vielen Freiheiten und bleiben auch Sie weiter vor allem schön gesund und munter, unternehmenslustig und literaturfreundlich und bis demnächst.
EDITION digital war vor 26 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.000 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()